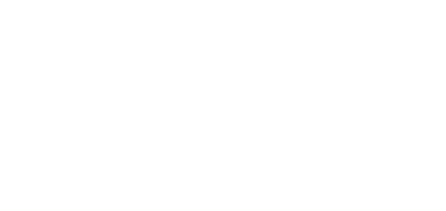Prof. Dr. Jana Zinkernagel
D-65366 Geisenheim
Raum 102
Von-Lade-Straße 2
65366 Geisenheim
Jana Zinkernagel studierte Gartenbauwissenschaften mit Schwerpunkt auf sekundäre Pflanzenstoffe an der Technischen Universität München, Weihenstephan. Im Anschluss arbeitete sie am Lehrstuhl für Phytopathologie der TUM und an der LfL Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an dem Thema Phytophthora an Saatkartoffeln. Jana Zinkernagel promovierte 2008 über die Hydrophysiologie von Spargel an der Justus Liebig Universität Gießen. Es folgte eine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Fachgebietsleiterin für Gemüsebau an der Forschungsanstalt Geisenheim. 2009 absolvierte sie einen Forschungsaufenthalt am INRA-Institut U.M.R. PIAF in Clermont-Ferrand zur hydraulischen Leitfähigkeit von Pflanzen. Im Dezember 2010 übernahm sie die Leitung des Instituts für Gemüsebau verbunden mit einer Professur für Gemüsebau an der Hochschule Geisenheim. Jana Zinkernagel ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft, Co-Koordinatorin des Europäischen Netzwerkes für gemüsebauliche Forschung, Arbeitsgruppe Düngung und Bewässerung, Mitglied des Kuratoriums für das landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratungswesen und Mitglied des EIP-Beirats, beide HMUKLV, u. w. Darüber hinaus ist sie als Gutachterin für Forschungsförderungen und wissenschaftliche Publikationen tätig.
Projektanfang: 01.05.2024
Projektende: 30.04.2027
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Die Diversifizierung von Anbausystemen unterstützt Nachhaltigkeit, Klimaresistenz und Ökosystemdienstleistungen, und soll in NSmartSystems im Kontext der Präzisionslandwirtschaft betrachtet werden. Es werden verschiedene Methoden und Open-Source-Tools entwickelt, um Diversifizierung und präzises Düngemanagement optimal zu kombinieren, damit Landwirtinnen und Landwirte so ihre Rentabilität verbessern und negative Umweltwirkungen reduzieren können. Die konkreten Ziele des NSmartSystems Projektes sind:
(1) Entwicklung von Entscheidungsunterstützungssystemen (DSS) zur Diversifizierung von Anbausystemen durch Fruchtfolgen und den intelligenten Einsatz von Zwischenfrüchten.
(2) Verbesserte Entscheidungsfindung bei der variablen N Düngung durch nutzerzentrierte, mehrparametrische Tools.
(3) Optimierung der variablen N Ausbringung im Feld durch eine verbesserte Abstimmung von
Applikationssystem und Ausbringgerät.
(4) Entwicklung von Instrumenten für Landwirtinnen und Landwirte, um die Auswirkungen ihrer Managemententscheidungen im Laufe der Zeit zu analysieren und zu überwachen.
Projektanfang: 15.09.2023
Projektende: 14.09.2026
Förderer: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
In the project UpgoeS, it will be tested whether organo-mineral (OM) substrate residues from hydroponic tomato cultivation can be upcycled and used as alternative fertilizers, for soil improvement and for yield and quality increases for outdoor vegetable cultivation at two geologically and climatically different locations (Berlin and Geisenheim). The organic fraction (wood fiber substrate) originates as residual material in a sawmill, whereas the mineral fraction are nutrient ions that accumulate in the wood fiber substrates during the cultivation period. The incorporation of OM substrate residues into field plots is expected to provide baseline knowledge on the resulting changes in physical soil properties, particularly air and water holding capacity, and reduced nitrogen leaching to groundwater. It is expected that the nitrate retention time will be increased and the water storage capacity will increase at the same time. Thus, both the drought stress tolerance of the soil in the era of climate change might be increased and the conventional fertilizer application and drinking water pollution due to nitrogen inputs should be reduced. This could imply a large savings potential in terms of production-related energy input for fertilizer production and CO2 emissions. In addition, the reuse of OM substrate residues can reduce the amount of growing media requiring disposal, thus improving the circular economy. Thus, biological resources are used that can be upcycled and used in cascades. Guidelines for the processing and proper use of OM substrate residues from hydroponic vegetable cultivation are to be developed with the involvement of decision-makers for outdoor vegetable cultivation, so that the use of raw materials with regard to both types of cultivation is more resource-conserving and sustainable.
Projektanfang: 14.06.2022
Projektende: 31.03.2023
Förderer: Europäische Kommission
Der Schwerpunkt der Hochschule Geisenheim in Forschung und Lehre liegt auf den Sonderkulturen und deren Produkten sowie der nachhaltigen Entwicklung von Kulturlandschaften und städtischen Freiräumen. Die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeitsziele und Biodiversitätsverlust sind essentieller Bestandteile aller Forschungsfragen, denen sich Geisenheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im regionalen aber auch nationalen und internationalen Kontext widmen. Sie stellen sich damit in ihren Fachbereichen den globalen Anforderungen und tragen zur Bewältigung der Klimakrise bei.
Die Hochschule hat fünf Forschungsfelder definiert, in denen sie sich den Anforderungen der heutigen Zeit im Bereich der gesamten Wertschöpfungskette der Sonderkulturen – von der Landschaft zum Anbau über primäre und sekundäre Verarbeitungsprodukte bis hin zur Vermarktung und Ökonomie – widmet.
1. Ertragssichere, qualitätsorientierte und nachhaltige Anbausysteme für Sonderkulturen entwickeln
2. Agrarische Produkte mit Schwerpunkt pflanzliche Erzeugnisse innovativ und sicher verarbeiten und vermarkten und im Sinne der Bioökonomie nutzen
3. Kulturlandschaften und städtische Freiräume zukunftsfähig gestalten und weiterentwickeln
4. Risiken des Klimawandels beurteilen und Strategien zur Anpassung und Minderung der Folgen erarbeiten
5. Digitalisierung in der Produktion und Vermarktung von Sonderkulturen und in der durch Landschaftsplanung verwirklichten Abläufe.
Um Nachhaltigkeitsaspekte in der Forschung auf breiter Basis zu verankern, wurde in diesem Projekt apparative Ausstattung für die anwendungsbezogene Forschungs- und Innovationsinfrastruktur im Kontext der Nachhaltigkeit beantragt. Die Infrastruktur kommt vier der fünf oben genannten Forschungsfelder zu Gute, häufig auch in Querschnittsfunktion über mehrere Bereiche.
Projektanfang: 23.03.2022
Projektende: 31.03.2023
Förderer: Europäische Kommission
In Folge des Klimawandels verursachen vor allem Extremwetterereignisse massive Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Durch die im Projekt aufgebaute Forschungsinfrastruktur werden neuartige systemische Bewirtschaftungs- und Lösungsansätze für einen nachhaltigen, Klimawandel-resilienten Sonderkulturanbau der Zukunft erarbeitet, erprobt, erforscht und weiterentwickelt. Dies schließt die doppelte Flächennutzung unter gleichzeitiger Energieerzeugung (SDG 7, ‚affordable and clean energy‘) mit der kulturbezogenen Nutzung dezentral erzeugter Energie zum Betrieb von (Robotik-)Infrastruktur mit ein (SDG 8 ‚decent work and economic growth‘), um Klimawandel-Resilienz und Nachhaltigkeit im Anbau zu evaluieren und zu stei-gern (SDG 12, ‚responsible production and consumption‘, SDG 13, ‚climate action‘ und SDG 15, ‚life on land‘). Hieraus ergibt sich ein sehr hohen Innovationsgrad.
Konkret werden diesem Falle Investitionen und Beschaffungen innerhalb von drei Projekten gefördert werden:
(1) Die Automatisierung, Digitalisierung und Robotik-Ausstattung im entstehenden Reallabor „VitiVoltaic“ in Bezug auf Reduktion von Pflanzenschutz
(2) Die Anlage und Ausstattung eines biodiversen, sortenvielfältigen Zukunftsweinbergs
(3) Die Ausstattung der Flächen des Gemüsebaus mit Mikro-Lysimetern, mit denen Stoff- und Energieflüsse im gewachsenen Bestand unter heutigen und künftigen klimatischen Bedingungen und CO2-Konzentrationen in zwei verschiedenen Anbausystemen (integriert und ökologisch) untersucht werden können.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert.
Projektanfang: 01.03.2022
Projektende: 28.02.2025
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Für die Einhaltung des 1,5°C und auch des 2,0°C Ziels ist nicht nur eine rasche Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen notwendig, sondern auch – zusätzlich – ein Netto-Entzug von CO2 aus der Atmosphäre (sog. Carbon Dioxide Removal, CDR). Es gibt vier terrestrischen CDR Methoden, die rasch umgesetzt werden können und von denen jede eine ganze Reihe von nachhaltigen Entwicklungszielen unterstützt (wie z.B. Ernährungssicherheit und saubere Umwelt):(1) pyrogene Kohlenstoffbindung (Pflanzenkohle), (2) Gesteinsmehl-Verwitterung („enhanced weathering“, EW), (3) Humusaufbau im Boden (SOC = soil organic carbon) und (4) Biomasse-Kohlenstoffbindung (BCC. Biomass carbon capture), zum Beispiel durch Nutzung von Agroforstsystemen. Um Kohlenstoff-Einbindung (pro Fläche) zu maximieren, müssen aber auch die Synergien dieser Methoden untersucht und verstanden werden. Sie wurde bisher fast ausschließlich separat untersucht – die möglichen Synergien sind Teil unserer PyMiCCS Projektziele. Pflanzenkohle und vulkanisches Gesteinsmehl für EW binden nicht nur Kohlenstoff in Böden, sondern gleichen auch den pH-Wert und das Redoxpotenzial des Bodens aus, liefern Nährstoffe, verbessern die Bodenhydrologie und fördern die biologische Vielfalt des Bodens, das Wurzelwachstum, die Ernteerträge und damit auch BCC. Wenn theoretisch zwei Tonnen Dünger auf Pflanzenkohlebasis und eine Tonne vulkanisches Gesteinsmehl jährlich pro Hektar ausgebracht werden, würden Kohlenstoffsenken von 5,4 t CO2eq entstehen – noch ganz ohne Synergien auf SOC und BCC. Hochskaliert auf 50% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen wären dies
13 Gt CO2eq bei verbesserter Produktivität von Nahrungs- und Futtermitteln. In verschiedensten iterativen Experimenten und Analysen vom Labor- bis zum Feldmaßstab, mit und ohne Böden und Pflanzen, erzeugen wir Daten zur Parametrisierung globaler Modelle für C-Senken-Potenzialanalysen und zur Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit.
Projektanfang: 01.02.2022
Projektende: 30.09.2025
Förderer: Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
Als Vorhaben zur Umsetzung des Ökoaktionsplanes 2020-2025 in Hessen werden in einem 3,5-jährigen Forschungsvorhaben Anbausysteme des ökologischen Gemüsebaus entwickelt mit dem Ziel einer verbesserten Resilienz gegenüber zukünftigen Umweltbedingungen. In Freilandexperimenten unter kontrollierten Bedingungen auf Ökoflächen der HGU sowie unter Praxisbedingungen (Living lab) werden Maßnahmen zur Steigerung der Wasserhaltekapazität bodenkundlich und pflanzenbaulich evaluiert. ÖkoBoden4Resilienz ist partizipativ und assoziiert zu dem Projekt „Aufbau und Etablierung des Praxisforschungsnetzwerk Ökolandbau Hessen“.
Projektanfang: 01.02.2020
Projektende: 31.05.2023
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Das Entscheidungshilfesystem GeoSenSys ist als GIS-basierte Webanwendung für den Freilandgemüsebau konzipiert, um Anwendern durch die gekoppelte Empfehlung einer teilflächenspezifischen Bewässerung und Stickstoff(N)-Düngung zu unterstützen.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines neuronalen Netzes zur Bewässerungssteuerung (Artificial Neuronal Network for Irrigation; ANNI) auf Grundlage der spektralen Reflexion der Modellkultur Spinat und gemessener Boden-, Pflanzen- und Umweltparameter an georeferenzierten Flächen.
Der Bewässerungsbedarf wird durch die Kombination der Wasserbilanz der Kultur mit der Geisenheimer Bewässerungssteuerung, Pflanzenparameter und spektralen Vegetationsindizes abgeleitet. Die wissenschaftliche Verifizierung des modellierten Wasserbedarfs erfolgt anschließend durch Messung der aktuellen Evapotranspiration mittels Eddy-Kovarianz-Analysen.
Um die Kopplung von Bewässerungs- und N-Düngungsentscheidungen zu ermöglichen, wird ein N-Mineralisierungsmodell entwickelt und mit dem Bewässerungsmodell verknüpft.
Dies führt zu einer einfachen Entscheidungsfindung für das Anbaumanagement im Gemüsebau. Durch die kleinräumige Abschätzung des Bewässerungs- und N-Düngebedarfs trägt dieses Projekt zu einer ressourceneffizienten und nachhaltigen Gemüseproduktion bei.
Projektanfang: 01.05.2018
Projektende: 31.10.2018
Förderer: Landwirtschaftliche Rentenbank
Projektanfang: 01.09.2016
Projektende: 31.08.2020
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Verbundprojekt EPoNa
Ertüchtigung von Abwasser-Ponds zur Erzeugung von Bewässerungswasser am Beispiel des Cuvelai-Etosha-Basins in Namibia
Teilprojekt der Hochschule Geisenheim University
Landwirtschaftliche Nutzung von Pondwasser und Klärschlamm und Entwicklung eines robusten Niederdruck-Bewässerungssystems
Projektanfang: 01.04.2016
Projektende: 31.03.2019
Förderer: Europäische Kommission, Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
Seit Jahren ist die „Gelben Welke“ an Feldsalat in Europa ein großes Problem. Bisher konnten viele abiotische und biotische Faktoren als Auslöser ausgeschlossen, aber die Ursache noch nicht identifiziert werden. Das Innovationsvorhaben im Rahmen EIP Agri beschäftigt sich sowohl mit der Klärung der Ursache mit Hilfe von Metabolom- & Metagenomanalysen als auch mit der Entwicklung von Bekämpfungsstrategien. Einen erfolgversprechenden Ansatz stellt eine thermische Behandlung des Bodens durch Solarisation dar.
Projektanfang: 01.04.2016
Projektende: 31.12.2018
Förderer: Europäische Kommission, Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
GS-Netz steht für „Geisenheimer Steuerung Netzwerk“ dessen Ziel es ist, ein innovatives Managementsystem zur Bewässerungssteuerung (die "GS-Mobil" App) für die gemüsebauliche Praxis zu entwickeln. Darüber hinaus sollen die resultierenden Erkenntnisse des Projekts in die Praxis transferiert werden. Die Entwicklung des Prototyps der "GS-Mobil" App wurde im Rahmen eines Innovationsvorhabens der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert.
Projektpartner sind neben der Hochschule Geisenheim University der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinpfalz, der Deutsche Wetterdienst, Helm Software, der Hessische Gärtnerei Verband sowie vier Gemüsebaubetriebe. Besonders hervorzuheben ist in diesem Netzwerk der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit aller Beteiligten, um eine stetige Weiterentwicklung der "GS-Mobil" App zu ermöglichen. GS-Netz ist ein Europäisches Innovationsprojekt welches durch die Europäische Union sowie das Land Hessen gefördert wird.
Projektanfang: 01.01.2016
Projektende: 31.12.2018
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Im Rahmen des Projekts GSEHEN entwickelt die Hochschule Geisenheim, Institut für Gemüsebau eine praktisch anwendbare Softwareumsetzung der Geisenheimer Steuerung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den für eine teilautomatische Realisierung der Geisenheimer Steuerung und der lückenlosen Dokumentation der für die Softwareumsetzung benötigten Algorithmen und Parameter.
Zum einen sollen Experimente die Qualität der Parameter nachhaltig überprüfen und sichern, zum anderen werden diese durch eine öffentlich verfügbare Datenbank für die automatische Softwareumsetzung zugänglich gemacht.
Diese Datenbank soll sicherstellen, dass zukünftig bei Berechnung der Geisenheimer Steuerung immer auf aktuelle und zuverlässige Basisdaten zurückgegriffen werden kann. Die im Laufe des Projekts entstehenden Programme und Dokumentationen sollen unter Open Source Lizenzen veröffentlicht werden. Dadurch kann eine qualitativ hochwertige und den wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechende Umsetzung der Geisenheimer Steuerung in jeglicher Form von Software gefördert werden.
Damit sichert das Projekt GSEHEN die praktische Anwendung und die wissenschaftliche Grundlage der Geisenheimer Steuerung auch in der Zukunft.
Projektanfang: 01.01.2016
Projektende: 31.12.2017
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Die Wirkung von CO2-Konzentration und Stickstoff-Form auf die Entwicklung, physiologische Parameter, Ertrag und inhaltsstoffliche Zusammensetzung von zwei Rucola-Sorten (Diplotaxis tenuifolia) wird in Klimaschränken untersucht.
Projektanfang: 01.01.2014
Projektende: 31.12.2017
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Im FACE2FACE Projekt werden die Folgen des Klimawandels auf Agrar-Ökosysteme wie Grünland und Sonderkulturen untersucht. Beim Anbau von Sonderkulturen stehen hierbei insbesondere die Pflanzenphysiologie sowie die Inhaltsstoffentwicklung im Vordergrund. Im Teilprojekt "AP 3.1 Inhaltsstoffe & Produktqualität - Gemüse" werden die Auswirkungen erhöhter CO2-Konzentrationen in Interaktion mit einem verringertem Wasserangebot auf die Inhaltsstoffzusammensetzung von Einlegegurke, Radieschen und Spinat untersucht.
Projektanfang: 01.01.2012
Projektende: 31.12.2015
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Im Rahmen eines durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geförderten Innovationsvorhabens bringt das Institut für Gemüsebau der Hochschule Geisenheim in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und Helm-Software unter dem Namen „GS-Mobil“ die Geisenheimer Bewässerungssteuerung für Feldgemüse noch näher an die Praxis.
Das Prinzip der Geisenheimer Steuerung beruht auf einer Bilanzierung von Referenzverdunstung, Niederschlag und Bewässerung. Dazu müssen vom Anwender kulturspezifische Daten erhoben werden.
Das Ziel der Forschung am Institut für Gemüsebau ist nun die Modellierung der Verdunstung der Pflanzen in Abhängigkeit vom Wachstum, um die vom Anwender erforderlichen Angaben zu minimieren. Hierfür konnte moderne Bewässerungs- und Messtechnik angeschafft werden, die den höchsten Qualitätsstandards entspricht. Die Verdunstung der Pflanzen dient dann als Grundlage für mobile Bewässerungsempfehlungen. Dazu wird Helm-Software die benötigte Netz-Infrastruktur schaffen und eine Smartphone-App entwickeln. Diese soll zukünftig Gemüsebauern in ganz Deutschland zuverlässige Bewässerungsempfehlungen auf Basis der vom DWD individuell bereitgestellten Verdunstungsdaten liefern. Mit diesem Projekt wird die gemüsebauliche Bewässerungsteuerung anwendungsfreundlicher, ressourcenschonender und zudem mobil.
Projektanfang: 01.01.2012
Projektende: 31.12.2016
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Verbesserte Bewässerungstechnik und -steuerung im Freilandgemüsebau soll helfen, die Ressourcen Wasser, Energie und Arbeit effizienter zu nutzen und hohe Erträge in guter Qualität zu sichern. Die intensive Beratung von je sechs Betrieben in Niedersachsen und Hessen/Rheinland-Pfalz im Modellvorhaben soll eine ressourcenschonende Bewässerung in die Praxis einführen. Hofseminare vermitteln die Erfahrungen aus diesen Pilotbetrieben zur effizienten Bewässerung an andere Betriebsleiter der Region.
Projektanfang: 01.01.2011
Projektende: 31.01.2015
Förderer: Fachzentrum Klimawandel Hessen
Zukünftige Veränderungen im Wasserbedarf und der Stickstoffdynamik von Gemüsekulturen werden für das Hessische Ried ermittelt, um Anpassungsstrategien und Anbauempfehlungen abzuleiten.
Klimaprojektionen mit den Globalmodellen ECHAM5 und HadCM3 im Szenario A1B und den Regionalisierungsmodellen WETTREG, REMO und CCLM sollen die Bandbreite möglicher Wasserbilanz-Veränderungen abbilden.
Die Wirkung jahreszeitlich veränderter Niederschlagsverteilungen auf den Nitrat-Austrag wird in Lysimeterversuchen bestimmt.
Projektanfang: 01.01.2011
Projektende: 31.12.2015
Förderer: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
„Gelbe Welke“ stellt den Anbau von Feldsalat wirtschaftlich zunehmend in Frage. Die Symptome stumpf grüner, waagrecht stehend bis schlaff herabhängender, stark vergilbender Blätter machen den Feldsalat unverkäuflich.
Voruntersuchungen zur Übertragbarkeit auf nicht symptomatische Flächen deuten auf bodenbürtige Ursachen hin. Die Suche nach möglichen Pathogenen im Hilfe mikrobiologischer Verfahren erfolgt in Gewächshaus- und Klimaschrank-Versuchen.
Datum: 21.11.2023
Ort: Kitzingen (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2023
Ort: Mutterstadt (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 15.03.2023
Ort: Grünberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 09.03.2023
Ort: Eisenstadt (Österreich)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 08.03.2023
Ort: Frick (Schweiz)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 09.02.2023
Ort: Augsburg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 31.01.2023
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 25.10.2022
Ort: Münzenberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 21.09.2022
Ort: Düren (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 14.09.2022
Ort: Gent (Belgien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 27.04.2022
Ort: Würzbung (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 29.01.2020
Ort: Gernsheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 21.10.2019
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 12.09.2019
Ort: Rauischholzhausen (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 10.09.2019
Ort: Pisa (Italien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 06.09.2019
Ort: Neckarsulm (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 28.06.2019
Ort: Bad Friedrichshall (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 17.06.2019
Ort: Matera (Italien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 05.06.2019
Ort: Berlin (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.10.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 14.09.2018
Ort: Bleiswijk (Niederlande)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 26.04.2018
Ort: Heidelberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 01.03.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 01.03.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 01.03.2018
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 27.01.2018
Ort: Gernsheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 23.01.2018
Ort: Untersiebenbrunn (Österreich)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 08.11.2017
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 25.10.2017
Ort: Mechelen (Belgien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 03.09.2017
Ort: Potsdam (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 30.05.2017
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 10.05.2017
Ort: Almeria (Spanien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 01.02.2017
Ort: Gernsheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 28.01.2017
Ort: Neustadt an der Weinstraße (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 24.01.2017
Ort: Grünberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 30.11.2016
Ort: Grünberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 28.11.2016
Ort: Stuttgart (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 18.10.2016
Ort: Chania (Griechenland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 13.10.2016
Ort: Bonn (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 05.10.2016
Ort: Potsdam (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 19.09.2016
Ort: Regenstauf (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 05.07.2016
Ort: Bamberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 22.06.2016
Ort: Griesheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 14.06.2016
Ort: Hassel (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 15.03.2016
Ort: Erfurt (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 10.03.2016
Ort: Grünberg (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 21.01.2016
Ort: Rauischholzhausen (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 09.07.2015
Ort: Babenhausen (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 10.06.2015
Ort: Lleida (Spanien)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 23.04.2015
Ort: Wiesbaden (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 16.02.2015
Ort: Amsterdam (Niederlande)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 30.01.2015
Ort: Koblenz (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 28.01.2015
Ort: Gernsheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 16.10.2014
Ort: Bonn (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 16.10.2014
Ort: Bonn (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 11.06.2014
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 26.05.2014
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 14.05.2014
Ort: Wiesbaden (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 31.03.2014
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana
Datum: 25.03.2014
Ort: Geisenheim (Deutschland)
Referent: Zinkernagel, Jana