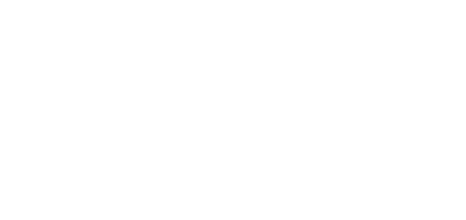Forschungsprojekte unseres Instituts
Projektanfang: 01.04.2024
Projektende: 31.03.2026
Förderer: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
Ziel des Projektes ist die Konzeption und Realisierung einer innovativen Gärgasfilteranlage im Prototypmaßstab von 100 m³ für Gäranlagen mit variablen Volumina (10.000 L - 100.000 L). Mit Hilfe eines Membranfilters soll diese Anlage in der Lage sein, gasförmiges CO2, das als Nebenprodukt bei der Weinvergärung entsteht, mit einer Reinheit von über 99,99% zu reinigen und zu speichern. Damit wird erstmals ein effizienter Kreislaufprozess möglich, bei dem das CO2 für die Wiederverwendung in der Weinproduktion aufbereitet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, soll eine Membran aus Silikon oder Polypropylen eingesetzt werden, deren geometrische Anordnung neu konzipiert wird, um eine Permeabilität von mehr als 10.000 GPU (Gas Permeance Unit) zu erreichen. Darüber hinaus soll die innovative Filtrationstechnologie unerwünschte Aromastoffe optimal zurückhalten, so dass das gefilterte und in den Gärtank zurückgeführte CO2 den Geschmack des Weines nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus soll durch die Entwicklung und Optimierung eines neuartigen Kompressordesigns die Effizienz der Anlage gesteigert werden, indem die Prozessschritte der CO2-Filtration durch den verbesserten Kompressor verkürzt werden.
Projektanfang: 17.06.2019
Projektende: 31.12.2025
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Die Bekämpfung des Falschen Mehltaus der Rebe, hervorgerufen durch Plasmopara viticola, ist eine der
großen Herausforderungen im Weinbau, insbesondere im ökologischen Weinbau. Aufgrund des drohenden
Verbots kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel und wegen massiver Auswirkungen des Klimawandels gerät
der ökologische Weinbau zunehmend in eine wirtschaftliche Krise. Daher ist das Ziel des beantragten
Verbundvorhabens "VITIFIT", einen Maßnahmenkatalog mit praxistauglichen Strategien zur
Gesunderhaltung der Rebe zu erarbeiten. So sollen Anbaubedingungen verbessert, die
Produktionssicherheit konsolidiert und damit betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit gewährleistet werden. Die
Bekämpfungsstrategien im Bereich der Pflanzengesundheit werden im Wesentlichen auf
Kupferminimierung (mikroverkapselte Kupfersalze) und Kupferersatz (Pflanzenextrakte; UVC-Technologie)
sowie deren Kombination basieren. Flankierende anbau- und kulturtechnische Maßnahmen sollen das
Inokulumpotential von P. viticola senken. Molekularbiologische Analysen werden sich dem pilzlichen
Mikrobiom des Blattes unter den o.g. Bedingungen widmen. Besonderes Augenmerk soll auf den
Pflanzenschutzmittelwirkstoff Kaliumphosphonat gelegt werden. Bereits existierende und neu gezüchtete
pilzwiderstandsfähige Rebsorten (PIWIs) spielen in den erarbeiteten Handlungskonzepten eine zentrale
Rolle. Hierbei stehen die Verbesserung der oenologischen Weinstilistik, die Marktakzeptanz von PIWIs
sowie deren betriebliche Einführung im Fokus. Die Züchtung von PIWIs soll durch die Identifikation neuer
Resistenzen gegen P. viticola und Einkreuzung in aktuelle Zuchtstämme vorangetrieben werden. Ein
weiterer Schwerpunkt sieht die Adaption des Prognosemodells "VitiMeteo Rebenperonospora" an PIWIs
vor. Im Sektor Wissens- und Technologietransfer sollen Kommunikation, Vernetzung und Informationsfluss
zwischen Forschung und Praxis optimiert werden. Das Projekt VITIFIT soll einen wesentlichen Beitrag zur
Erreichung des "20%-Zieles" leisten.
Projektanfang: 01.01.2018
Projektende: 31.12.2025
Förderer: Université franco-allemande | Deutsch-Französische Hochschule
Projektanfang: 01.09.2020
Projektende: 31.08.2023
Förderer: Landwirtschaftliche Rentenbank
“Witality - Wine in Virtual Reality” stellt ein Verbundprojekt aus Wissenschaft und Praxis dar. Die am Projekt beteiligten Institutionen Hochschule Geisenheim, Institut für Oenologie (HGU), Hochschule Bonn-Rhein Sieg, Institut für Visual Computing (H-BRS), Pieroth Wein AG (PR) und DLG Test Service GmbH (DLG) ermöglichen einen engen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis zum Einsatz virtueller Realität (VR) für die sensorische Analyse von Wein.
Durch die Hochschule Bonn-Rhein Sieg soll eine VR-Software entwickelt werden, die die Simulation von typischen Verkostungssituationen wie beispielsweise Bar oder Vinothek ermöglicht. Mit Datenbrillen können die Verkostungsteilnehmer/innen in die virtuelle Realität eintauchen.
Die Hochschule Geisenheim wird zu Beginn des Projektes ermitteln, wie auditive, olfaktorische und akustische Stimuli unter VR die sensorische Bewertung von Wein beeinflussen. Die simulierten Situation werden dabei im Vergleich zur neutralen Bewertung innerhalb eines standardisierten Sensorik Labors analysiert. In einem nachfolgenden Schritt soll geprüft werden, wie sich die sensorische Bewertung von Proben unter unterschiedlichen Bedingungen (z.B. neutrales, standardisiertes Sensorik Labor, Vinothek vs. Vinothek unter VR-Simulation) verändert.
Die Praxistauglichkeit der Datenbrillen und Software wird durch die Pieroth Wein AG und die DLG Testservice GmbH geprüft.
Am Ende des Projektes soll den Akteuren der Weinbranche ein Tool zur Verfügung gestellt werden, das innerhalb vieler praxisrelevanter sensorischer Fragestellungen eingesetzt werden kann und damit der Erschließung neuer Marktsegmente und Kundengruppen dient.
Projektanfang: 01.01.2021
Projektende: 31.12.2021
Förderer: Deutscher Akademischer Auslandsdienst
Wein ist in kaukasischen Ländern sowohl wirtschaftlich als auch kulturell sehr wichtig. In den vergangenen Jahren ist die Bedeutung der Weinwirtschaft stark gestiegen, insbesondere dadurch, dass ein Großteil der Weinproduktion exportiert wird. Hierbei haben die attraktiven Märkte im europäischen und außereuropäischen Ausland in den vergangenen Jahren als Exportdestinationen an Bedeutung gewonnen. Die hohe Wettbewerbsintensität auf diesen Märkten setzt die sichere Anwendung von wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen voraus. Aufgrund der hohen Preise der kaukasischen Weine spielt im Export insbesondere der Fachhandel als Vertriebsweg eine herausragende Rolle. Aus diesem Grund wurde der Schwerpunkt der Sommerschule um den Themenkomplex „Fachhandel“ erweitert.
Für den Absatz des Weines im Kaukasus spielt der Weintourismus eine immer wichtigere Rolle - beispielhaft ist hier die Förderpolitik der Regierungen sowie die Aktivitäten der GIZ im Kaukasus. Um der Bedeutung gerecht zu werden, wurde dieses Thema sowohl als Vorlesung als auch als Exkursionsziel aufgegriffen.
Projektanfang: 01.01.2020
Projektende: 31.12.2020
Förderer: Deutscher Akademischer Auslandsdienst
Das akademische Programm, das 25 thematische Sessions umfasste, wurde von der Hochschule Geisenheim zusammengestellt. Die erste digitale pan-kaukasische Sommerschule "West Meets East" befasste sich mit verschiedenen Themen wie Weltweinmärkte, Strategie, Weinmarketing, Weinbau und Weinerzeugung in Deutschland, Armenien und Georgien. Die Vertreter der führenden Weininstitutionen und Branchenexperten aus Deutschland, Georgien und Armenien gaben tiefe Einblicke in die aktuellen Entwicklungen von Weinexport, -import und -konsum in diesen drei Ländern. Darüber hinaus war die Einzigartigkeit der Qvevri-Weinbereitung ein integraler Bestandteil der digitalen Veranstaltung.
Projektanfang: 01.03.2017
Projektende: 31.08.2020
Förderer: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Die Diskussionen über Schwermetallgehalte in Getränken sind nicht neu, sondern begleiten die Getränkewirtschaft seit vielen Jahrzehnten. Vor allem der toxische Aspekt vieler Schwermetalle ist Grundlage für die Einführung von Grenzwerten, die aufgrund neuer Befunde eine ständige Anpassung erfahren. Nicht zuletzt wegen dieser zunehmenden Diskussion über den Einfluss verschiedener Schwermetalle auf die Gesundheit ist es für die Hersteller wichtig, die Herkunftsquellen für Schwermetalle in Fruchtsäften einzugrenzen und Vermeidungsstrategien für den Eintrag zu entwickeln. In einigen Ländern hat man begonnen, für Apfelsäfte die gleichen Grenzwerte wie für Trinkwasser zu fordern. Teilweise werden in einzelnen Ländern nur noch 10 % der bisherigen Grenzwerte akzeptiert, wobei auch der Einfluss von NGOs in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Viele Apfelsäfte, als wichtigstes Produkt der deutschen Fruchtsaftindustrie, sowie weitere Fruchtsäfte des Handels würden dann bestimmte, neu festgelegte Grenzwerte überschreiten.
Projektanfang: 01.01.2018
Projektende: 31.12.2019
Förderer: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V.
Im Rahmen des vom Ausschuss für Technik und Wein (ATW) geförderten Projektes, soll mit Hilfe der „Food Pairing“ und des „Food Completing“ Theorie auf wissenschaftlicher Basis eine Erklärung dafür gefunden werden, warum bestimmte Speisen und Getränkekombinationen harmonieren und andere nicht.
Durch hedonische sensorische Prüfungen mit Konsumenten, ergänzt durch deskriptive Analysen, sollen beispielhaft die Wirkungsweisen zwischen Speisen und Wein aufgezeigt werden. Ziel ist es, exemplarische Kombinationsmöglichkeiten zu entwickeln und vorzustellen, die vom Praktiker beispielsweise im Rahmen eigener Weinproben genutzt werden können.
Projektanfang: 01.11.2014
Projektende: 31.05.2018
Förderer: Forschungsring des Deutschen Weinbaus, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V.
Haben Sie im Weinregal schon einmal nach einer Flasche Wein mit der Aufschrift „Alte Reben“ gegriffen? Warum? Verspricht das Alter der Rebstöcke eine besondere Qualität? Winzer begründen diese höhere Qualität gerne mit geringeren Erträgen, tieferem Wurzelsystem oder mit der besonderen genetischen Herkunft der Rebstöcke. Im Probierglas werden dann Weine miteinander verglichen, die zwar von der gleichen Rebsorte stammen mögen, sich aber ansonsten hinsichtlich vieler Faktoren unterscheiden. Ob Wein von alten Reben tatsächlich besser schmeckt als der von jungen Reben, untersuchte die Hochschule Geisenheim in einem speziellen Versuchsweinberg. Auf dieser experimentellen Basis ist es möglich, Untersuchungen innerhalb einer Rebfläche (Geisenheimer Fuchsberg), für eine Rebsorte (Riesling) gleichen Klons (Gm 239), gleicher Unterlage (5C Teleki) und auf einheitlichem Standraum (2,8m2) an Reben der drei Pflanzjahre 1971 („alt“), 1995 („alternd“) und 2012 („jung“) durchzuführen.
Zunächst seien einige Vorbemerkungen zu diesem Thema erlaubt, denn Reben besitzen ein sehr gutes Potenzial, um über eine lange Zeit vital zu bleiben. Auch finden in älteren Weinbergen aufgrund anderer Stock- und Zeilenabstände möglicherweise weniger mechanische Stockarbeiten statt, die das Risiko weiterer Stockausfälle reduzieren. Das Durchwurzelungsvermögen von Reben ist von größter Bedeutung und könnten eine wichtige Anpassungsreaktion alter Reben sein. Darüber hinaus erhöhen alte Weinberge die Diversität einer Sorte.
Ziel des Vorhabens war es zu untersuchen, ob sich die Nährstoffaufnahme ändert, Physiologie, Wachstum und Mikroklima beeinflusst werden oder sich Änderungen bei Most- und Weininhaltsstoffe zeigen, die sich auch auf die Sensorik auswirken. Der Untersuchungszeitraum betrug vier Versuchsjahre.
Projektanfang: 01.06.2010
Projektende: 31.03.2013
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Reifeverzögerung sowie die Weinqualität zu untersuchen.
Wärmere Witterungsperioden haben die phänologische Entwicklung vieler Pflanzen verändert. Bei der Rebe betrifft dies insbesondere Austrieb, Blüte, Véraison, Reife und folglich auch das Vinifizieren der Weine. Veränderungen der Laubwand können signifikante Unterschiede im Mikroklima und bei der Photosynthese bedingen.
Der Zeitpunkt, die Position der Eingriffe am Rebstock und die Intensität der Entblätterungen sind bei den unterschiedlichen Varianten von Bedeutung. Daher wurden Teilentblätterungen zu verschiedenen Zeitpunkten während der Vegetationsperiode im Hinblick auf die Zuckereinlagerungsgeschwindigkeit untersucht.
Material und Methoden
Die Feldversuche wurden mit den Rebsorten ’Riesling’, ‘Müller-Thurgau’, ‘Weißburgunder’ und ‘Grauburgunder’ in den Versuchsflächen der Hochschule Geisenheim durchgeführt. Die verschiedenen Maßnahmen wurden unmittelbar nach der Blüte implementiert, die unterschiedlichen Schattierungsnetze wurden für den Zeitraum von 32 (2012 und 2013) bis 70 Tage (2011) angebracht.
Für die Bestimmung des Wachstums und der Blattflächen wurden verschiedene Verfahren (Spektrale Reflektion) eingesetzt. Für die Bewertung der Traubenqualität wurden verschiedene Reifeparameter (vergl. 2.2.5) wie Einzelbeerengewicht, Dichte, Gesamtsäure, pH-Wert und hefeverfügbarer Stickstoff (α-Aminosäuren: NOPA) jeder Variante analysiert.