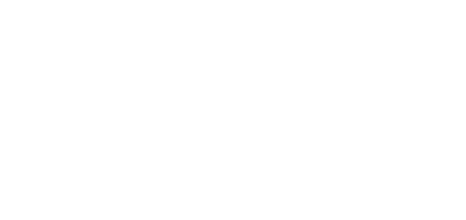wissenschaft.praxis.diskurs.
Das Kompetenzzentrum Kulturlandschaft (KULT) bearbeitet in einem kooperativen Netzwerk aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung von Kulturlandschaften. Hierzu führen wir Veranstaltungen, Weiterbildungen und Projekte durch und bringen damit die Entwicklung fachlicher Standards voran.
Kulturlandschaften unterliegen in der heutigen Moderne einem starken Änderungsdruck und Wandel. Die Inanspruchnahme der Landschaften durch Intensivierung der Landnutzung (Land- und Forstwirtschaft, Siedlungsbau, Energiegewinnung etc.) führt zu immer tiefgreifenderen Veränderungen dieser hochwertigen Kulturlandschaften. Wertbestimmende Merkmale gehen unwiederbringlich verloren – wie z. B. historische Elemente und biologische Vielfalt.
Am 4. September 2025 findet an der Hochschule Geisenheim die siebte Tagung „Straße und Landschaft“ statt. Unter dem Titel „Wasser als Schlüsselfaktor für eine nachhaltigere Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur“ widmet sich die Veranstaltung aktuellen Herausforderungen im Umgang mit Wasser im Straßenbau. Angesichts des Klimawandels und seiner Auswirkungen auf den Wasserhaushalt rückt Wasser zunehmend als strategisches Element in den Fokus von Planung und Bau. Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis diskutieren in Vorträgen und Beispielen über technische Lösungen, naturschutzfachliche Aspekte und neue Formen der Zusammenarbeit. Die Tagung richtet sich an Fachleute aus Straßenbau, Wasserwirtschaft, Landespflege und verwandten Bereichen. Beginn ist um 10:00 Uhr, die Teilnahme kostet 50 Euro und ist mit vorheriger Anmeldungbis zum 27. August möglich. Veranstaltungsort ist der Hörsaal 50 auf dem Campus der Hochschule Geisenheim.
Anmeldung Online bis zum 27. August 2025 unter: https://veranstaltungen.hs-geisenheim.de/event/7-sl2025