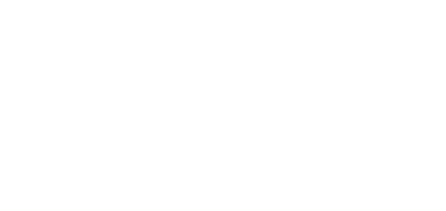Prof. Dr. Claudia Kammann
Organisationseinheit(en):Institut für angewandte ÖkologieProfessur für Klimafolgenforschung an Sonderkulturen
D-65366 Geisenheim
Raum 00.04
Von-Lade-Straße 2
65366 Geisenheim
Projektanfang: 01.01.2024
Projektende: 31.12.2025
Förderer: Deutscher Akademischer Auslandsdienst
Das nationale Treibhausgasbudget Pakistans stützt sich nicht auf reale Messungen, sondern auf IPCC Faktoren, da es keine Infrastruktur zur Messung der stabiler Treibhausgase (N2O, CH4, CO2) gibt. Daher könnten die tatsächlichen THG-Emissionen falsch eingeschätzt werden und das Bewusstsein für Minderungsmaßnahmen fehlt. Eine neuartige Technik (MIRA; https://aerissensors.com/) ermöglicht die Messung der Konzentration von THG mit einem robusten tragbaren Analysator direkt im Feld mit höherer Präzision bei geringeren Kosten als über Gaschromatographie. Die Gruppe Kammann verfügt über einen MIRA CO2/N2O-Analysator. In „AssessGHG-RemoveC“ sind jährliche THG-Summer Schools in Deutschland in 2024 und 2025 geplant, bei denen je 6 bzw. 7 pakistanische Wissenschaftler*innen zusammen mit 10 deutschen Nachwuchswissenschaftler*innen ausgebildet werden. Die pakistanischen Teilnehmer*innen verpflichten sich dazu, das Gelernte in einem THG-Workshop an der NUST weiter zu geben (Multiplikatoransatz); HGU-Kolleginnen unterstützen und bringen Messgeräte mit. Der THG-Workshop in Pakistan findet jeweils zeitgleich mit einer Biochar Academy statt. Herstellung und Verwendung von Biochar ist eine etablierte CDR-Technologie (carbon dioxide removal), die C-Senken in Böden mit vielen Vorteilen für die Landwirtschaft in subtropischen/tropischen Klimaten vereint. Ziel ist es, ländliche Biochar-Produktion und Nutzung durch den wachsenden globalen Handel mit Kohlenstoffsenken zu inzentiveren. Durch eine neue Zertifizierungsrichtlinie für Länder mit kleinbäuerlicher Kultur wurde die Voraussetzung für C-Senken Zahlungen an Kleinbauern geschaffen. Hierzu finden jährlich Biochar-Akademien an der NUST in Pakistan mit Unterstützung der Internationalen Biochar-Initiative und Carbon Standards International statt. Workshops / Akademien werden zur Netzwerkbildung und problemorientiert konzipiert.
Projektanfang: 01.01.2024
Projektende: 31.12.2027
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Die Anpassung an den Klimawandel mit zunehmender Trockenheit ist derzeit eine der größten Herausforderungen für die Landwirtschaft. Über die Integration tiefwurzelnder annueller oder mehrjähriger Pfahlwurzelpflanzen in die Fruchtfolgen können Mischkulturen Ressourcen effizienter nutzen und es ist somit höhere Trockenstresstoleranz zu erwarten. Gleichzeitig sollten Pflanzengesundheit, Klimaschutz durch Kohlenstoffspeicherung in den Böden und Artenvielfalt zunehmen. Diese Hypothesen prüft das Projekt „TRIO: Transformative Mischkultursysteme für One Health“, das als Verbundprojekt zwischen der Hochschule Geisenheim und den Universitäten Kassel und Gießen bearbeitet wird und über ein LOEWE-Schwerpunktprogramm gefördert wird, über den gemeinsamen Anbau der Heil- und Gewürzpflanzen Fenchel, Kümmel und Koriander als Mischkulturpartner mit Weizen. Im Institut für Phytomedizin der Hochschule Geisenheim wird das Teilprojekt „Diversität, Nahrungsnetze und Wanderbewegungen von Arthropoden in Mischkultursystemen“ untersucht. Arthropoden erbringen wichtige Ökosystemleistungen, die u.a. relevant für Pflanzengesundheit und Ertrag sind. Entsprechend der Hypothese der biotischen Resistenz kann biologische Vielfalt in einem Anbausystem die Schäden durch Schädlinge mindern und zugleich die Produktivität erhöhen. Dies wird in diesem Teilprojekt über eine vergleichende Analyse der Arthropodendiversität und ihren ökosystemaren Funktionen in Misch- im Vergleich zu den entsprechenden Reinkulturen geprüft und vergleichend analysiert. Neben der Analyse der Diversität werden Wanderbewegungen von Nutzarthropoden zwischen Mischungspartnern erfasst und volatile Pflanzenstoffe der Mischungspartner hinsichtlich ihrer Attraktivität für ausgewählte Nützlinge und Schädlinge in Wahlversuchen bewertet.
Projektanfang: 01.07.2023
Projektende: 30.06.2026
Förderer: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Der Erhalt und die Vermehrung städtischen Grüns, insbesondere von Bäumen, spielen eine zentrale Rolle bei der Anpassung von Städten an den Klimawandel, da sie eine natürliche Kühlung ermöglichen. Größere Bäume transpirieren bis 500 Liter Wasser pro Tag. Schatten und Verdunstungskälte mindern den Effekt urbaner Hitzeinseln. Streusalz, Bodenverdichtung und Schadstoffe belasten Stadtbäume jedoch. Hitze und Trockenheit intensivieren sich, sodass Neupflanzungen oft nicht anwachsen und Bestandsbäume vermehrt absterben, bevor sie eine klimawirksame Größe erreichen. Alternative Baumsubstrate könnten hier Abhilfe schaffen und auch die Infiltration von Wasser aus Starkregenereignissen verbessern. Ein vielversprechender Ansatz sind Pflanzenkohle-Macadam-Substrate (PMS), d.h. definierte Gemische aus Gesteinsschotter, Pflanzenkohle und Kompost. Der Schotter ergibt nach Verdichtung eine befahrbare, aber porenreiche Struktur, die Raum und Luft für Wurzelwachstum schafft und hohe Niederschläge aufnehmen können. Durch die Herstellung der Pflanzenkohle wird zudem Biomasse-Kohlenstoff langfristig gebunden (Kohlenstoffsenken). PMS wurden in Stockholm entwickelt und werden bisher nur in Schweden, Österreich und der Schweiz angewendet. Das Ziel von "Black2GoGreen" ist der Aufbau eines Netzwerks aus Kommunen, kommunalen Betrieben, Verbänden sowie Herstellern von Pflanzenkohle und Substraten, um Wissen über bereits implementierte Lösungen nach Deutschland zu transferieren.
Projektanfang: 01.05.2023
Projektende: 31.12.2023
Förderer: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V.
Das Vorhaben setzt sich zum Ziel, ein Industriegespräch zur doppelten Flächennutzung bei Sonderkulturen zu veranstalten. Hierzu soll im Vorfeld von der Arbeitsgruppe ein Übersichtsbeitrag in Fachzeitschriften erstellt werden. Im Mittelpunkt steht das ATW-HGU Industriegespräch zum Thema Agri- Photovoltaik (APV), das eine offene Diskussionsplattform zu diesem Thema bietet. Hierzu ist es erwünscht, die Kontakte der DLG zu nutzen und über das KTBL das Industriegespräch organisatorisch zu unterstützen, sodass das Thema auch auf weitere Sonderkulturen übertragen werden kann. In Form einer Maschinenvorführung soll das Thema der autonomen, elektrifizierten Bewirtschaftung sowie der Innovationen in diesem Bereich v.a. in Kombination mit der Agri-PV Stromerzeugung praxisnah mit aufgegriffen werden.
Projektanfang: 01.05.2023
Projektende: 30.04.2029
Förderer: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Im Projekt HUMAX sollen verschiedene Maßnahmen zum Humusaufbau in unterschiedlichen Kombinationen untersucht werden. Ziel ist es, mögliche Synergien der Maßnahmen zu identifizieren und kombinierte Anwendungsoptionen aufzuzeigen. Das innovative Potenzial des Projektes HUMAX liegt darin, dass etablierte Maßnahmen des Humusaufbaus (Zwischenfrüchte, Winterbegrünung, Untersaaten, Kompostapplikation, u.a.) mit vielversprechenden Maßnahmen wie Pflanzenkohle, u.a. kombiniert und getestet werden sollen. Ein Alleinstellungsmerkmal des Projektes HUMAX ist es, dass diese Maßnahmen in Kombination mit Agri-Photovoltaik- Anlagen und Agroforstsystemen angewendet werden sollen. Die Verbindung mit Agroforstsystemen eröffnet dabei, neben dem Humusaufbau, weitere Potenziale als Kohlenstoffsenke, da die Bäume und Sträucher Kohlenstoff in der ober- und unterirdischen Biomasse speichern und darüber hinaus noch ein großes Substitutionspotenzial durch die Holzprodukte und das beim Management der Gehölze anfallende Material mit sich bringen. Dieses soll genau quantifiziert werden um auf diese Weise nicht nur Aussagen über die gesamte Kohlenstoffspeicherung im Boden und der Biomasse treffen zu können, sondern auch die Substitutionseffekte und Biomassepotentiale für die Pflanzenkohleproduktion durch Pyrolyse quantifizieren zu können. Durch die Kombinationen der verschiedenen humusaufbauenden Maßnahmen sollen Wege gefunden werden, den Humusaufbau und damit die Kohlenstoffbindung, d.h. die Funktion des Bodens als C-Senke zu maximieren. Darauf aufbauend soll ein modulares System entwickelt werden, das es Landwirt*innen erlaubt, die für ihre Rahmenbedingungen bestmögliche Maßnahmenkombination für ein gezieltes Kohlenstoff- und Humusmanagement in ihrem Betrieb zusammenzustellen
Projektanfang: 01.01.2023
Projektende: 31.12.2025
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ziel des Projekts ist die erstmalige Entwicklung und Erprobung einer ästhetisch ansprechenden, mobilen, also mit geringem Aufwand auf- und abbaubaren PV-Anlage für die Nutzung in Weinbergen (Viti-PV-Anlage), welche die Winzer überall dort einsetzen können, wo der Bedarf nach Schutz und Verschattung sowie künftig für regenerative Energie im Weinbau selbst (Digitalisierung) besonders hoch ist. Die Ausgestaltung soll auf weitere Reihenkulturen (Obstbau) übertragbar sein, was durch die Expertise des Partners HGU gewährleistet ist. Damit sollen gleichzeitig die Ziele der Energiewende und des Weinbaus, nämlich Anpassung an den Klimawandel, Digitalisierung und reduzierter Pestizideinsatz bzw. gesteigerter Nachhaltigkeit erreicht werden, in dem Synergien über eine doppelte Flächennutzung hinaus identifiziert und nutzbar gemacht werden. Basierend auf weitreichenden Erfahrungen in der Planung von Anlagen und beweglichen Strukturen zur Nutzung der Solarenergie soll eine maßgeschneiderte Anlage für den Einsatz im Weinbau geplant, gefertigt und erprobt werden. Die weinbauliche Eignung und die Akzeptanz bei Winzern und Bevölkerung in verschiedenen Regionen Deutschlands werden untersucht. Die Ergebnisverwertung ist wissenschaftlich (Weinbau, Akzeptanz, Energieertrag) und auch kommerziell: Die wirtschaftliche Verwertung durch das KMU soll durch die Lizenzierung des entwickelten Systems oder die Fertigung durch ein Partnerunternehmen und bei Vermarktung durch das KMU erfolgen.
Projektanfang: 14.06.2022
Projektende: 31.03.2023
Förderer: Europäische Kommission
Der Schwerpunkt der Hochschule Geisenheim in Forschung und Lehre liegt auf den Sonderkulturen und deren Produkten sowie der nachhaltigen Entwicklung von Kulturlandschaften und städtischen Freiräumen. Die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeitsziele und Biodiversitätsverlust sind essentieller Bestandteile aller Forschungsfragen, denen sich Geisenheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im regionalen aber auch nationalen und internationalen Kontext widmen. Sie stellen sich damit in ihren Fachbereichen den globalen Anforderungen und tragen zur Bewältigung der Klimakrise bei.
Die Hochschule hat fünf Forschungsfelder definiert, in denen sie sich den Anforderungen der heutigen Zeit im Bereich der gesamten Wertschöpfungskette der Sonderkulturen – von der Landschaft zum Anbau über primäre und sekundäre Verarbeitungsprodukte bis hin zur Vermarktung und Ökonomie – widmet.
1. Ertragssichere, qualitätsorientierte und nachhaltige Anbausysteme für Sonderkulturen entwickeln
2. Agrarische Produkte mit Schwerpunkt pflanzliche Erzeugnisse innovativ und sicher verarbeiten und vermarkten und im Sinne der Bioökonomie nutzen
3. Kulturlandschaften und städtische Freiräume zukunftsfähig gestalten und weiterentwickeln
4. Risiken des Klimawandels beurteilen und Strategien zur Anpassung und Minderung der Folgen erarbeiten
5. Digitalisierung in der Produktion und Vermarktung von Sonderkulturen und in der durch Landschaftsplanung verwirklichten Abläufe.
Um Nachhaltigkeitsaspekte in der Forschung auf breiter Basis zu verankern, wurde in diesem Projekt apparative Ausstattung für die anwendungsbezogene Forschungs- und Innovationsinfrastruktur im Kontext der Nachhaltigkeit beantragt. Die Infrastruktur kommt vier der fünf oben genannten Forschungsfelder zu Gute, häufig auch in Querschnittsfunktion über mehrere Bereiche.
Projektanfang: 23.03.2022
Projektende: 31.03.2023
Förderer: Europäische Kommission
In Folge des Klimawandels verursachen vor allem Extremwetterereignisse massive Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Durch die im Projekt aufgebaute Forschungsinfrastruktur werden neuartige systemische Bewirtschaftungs- und Lösungsansätze für einen nachhaltigen, Klimawandel-resilienten Sonderkulturanbau der Zukunft erarbeitet, erprobt, erforscht und weiterentwickelt. Dies schließt die doppelte Flächennutzung unter gleichzeitiger Energieerzeugung (SDG 7, ‚affordable and clean energy‘) mit der kulturbezogenen Nutzung dezentral erzeugter Energie zum Betrieb von (Robotik-)Infrastruktur mit ein (SDG 8 ‚decent work and economic growth‘), um Klimawandel-Resilienz und Nachhaltigkeit im Anbau zu evaluieren und zu stei-gern (SDG 12, ‚responsible production and consumption‘, SDG 13, ‚climate action‘ und SDG 15, ‚life on land‘). Hieraus ergibt sich ein sehr hohen Innovationsgrad.
Konkret werden diesem Falle Investitionen und Beschaffungen innerhalb von drei Projekten gefördert werden:
(1) Die Automatisierung, Digitalisierung und Robotik-Ausstattung im entstehenden Reallabor „VitiVoltaic“ in Bezug auf Reduktion von Pflanzenschutz
(2) Die Anlage und Ausstattung eines biodiversen, sortenvielfältigen Zukunftsweinbergs
(3) Die Ausstattung der Flächen des Gemüsebaus mit Mikro-Lysimetern, mit denen Stoff- und Energieflüsse im gewachsenen Bestand unter heutigen und künftigen klimatischen Bedingungen und CO2-Konzentrationen in zwei verschiedenen Anbausystemen (integriert und ökologisch) untersucht werden können.
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert.
Projektanfang: 01.03.2022
Projektende: 28.02.2025
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Für die Einhaltung des 1,5°C und auch des 2,0°C Ziels ist nicht nur eine rasche Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen notwendig, sondern auch – zusätzlich – ein Netto-Entzug von CO2 aus der Atmosphäre (sog. Carbon Dioxide Removal, CDR). Es gibt vier terrestrischen CDR Methoden, die rasch umgesetzt werden können und von denen jede eine ganze Reihe von nachhaltigen Entwicklungszielen unterstützt (wie z.B. Ernährungssicherheit und saubere Umwelt):(1) pyrogene Kohlenstoffbindung (Pflanzenkohle), (2) Gesteinsmehl-Verwitterung („enhanced weathering“, EW), (3) Humusaufbau im Boden (SOC = soil organic carbon) und (4) Biomasse-Kohlenstoffbindung (BCC. Biomass carbon capture), zum Beispiel durch Nutzung von Agroforstsystemen. Um Kohlenstoff-Einbindung (pro Fläche) zu maximieren, müssen aber auch die Synergien dieser Methoden untersucht und verstanden werden. Sie wurde bisher fast ausschließlich separat untersucht – die möglichen Synergien sind Teil unserer PyMiCCS Projektziele. Pflanzenkohle und vulkanisches Gesteinsmehl für EW binden nicht nur Kohlenstoff in Böden, sondern gleichen auch den pH-Wert und das Redoxpotenzial des Bodens aus, liefern Nährstoffe, verbessern die Bodenhydrologie und fördern die biologische Vielfalt des Bodens, das Wurzelwachstum, die Ernteerträge und damit auch BCC. Wenn theoretisch zwei Tonnen Dünger auf Pflanzenkohlebasis und eine Tonne vulkanisches Gesteinsmehl jährlich pro Hektar ausgebracht werden, würden Kohlenstoffsenken von 5,4 t CO2eq entstehen – noch ganz ohne Synergien auf SOC und BCC. Hochskaliert auf 50% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen wären dies
13 Gt CO2eq bei verbesserter Produktivität von Nahrungs- und Futtermitteln. In verschiedensten iterativen Experimenten und Analysen vom Labor- bis zum Feldmaßstab, mit und ohne Böden und Pflanzen, erzeugen wir Daten zur Parametrisierung globaler Modelle für C-Senken-Potenzialanalysen und zur Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit.
Projektanfang: 01.11.2021
Projektende: 31.10.2022
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Um gesetzte Klimaschutzziele zu erreichen, erfordert es ehrgeizige Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Da ein Großteil dieser Emissionen im urbanen Raum verursacht wird, spielen Städte und Kommunen bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle. Um den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu gewährleisten und Klimaschutzpläne regelmäßig lokal anpassen zu können, muss die Reduktion der Emissionen kontinuierlich überprüft werden.
Das bisherige Monitoring weist aufgrund seiner Abhängigkeit von einer umfangreichen, jedoch oft eingeschränkten Datenverfügbarkeit Schwachstellen auf. Daher arbeitet die Hochschule Geisenheim in diesem Gemeinschaftsprojekt zusammen mit der Hochschule Darmstadt an der Entwicklung eines innovativen Sensornetzwerks für die lokale Bestimmung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre, um somit den Kommunen neue Monitoring-Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen der kommunale Klimaschutz besser gesteuert werden kann.
Auf der technischen Seite entwickelt die Hochschule Darmstadt einen präzisen und dennoch preiswerten CO2-Sensor, mit dem das Sensornetzwerk für die lokale Überwachung des CO2-Gehalts aufgebaut werden kann. Auf der Anwendungsseite ermittelt die Hochschule Geisenheim konkrete Einsatzfelder der Sensoren für das lokale Monitoring der Treibhausgasemissionen und entwickelt Ideen für begleitende Instrumente für effektiven Klimaschutz in den hessischen Kommunen.
Im Rahmen des Projekts werden bereits erste konkrete Schritte zur Realisierung des Sensornetzwerks und zur Verbesserung des kommunalen Klimaschutz-Monitorings gegangen. Um das Sensornetzwerk optimal einsetzen zu können werden Expert:innen aus Klimaschutzpolitik und -beratung, Industrie und Stadtverwaltung frühzeitig in das Vorhaben mit einbezogen.
Projektanfang: 01.07.2020
Projektende: 31.12.2022
Förderer: Europäische Kommission, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Im Rahmen von "APV-Weinbau4Real" soll eine für den Weinbau adaptierte Agro-PV-Forschungsinfrastruktur auf einer Nord-Süd gezeilten Weinbau-Versuchsfläche der Hochschule Geisenheim konzipiert und errichtet werden, um als Reallabor
(a) die Infrastruktur für die weinbauliche Forschung zu schaffen,
(b) erstmalig Betriebsdaten im realen Betrieb zu erheben (Stromerzeugung, Kosten, Benefits),
(c) als Innovationsplattform für weitere assoziierte Forschung zur Verfügung zu stehen und
(d) den Wissenstransfer für Weinbaubetriebe, die interessierte Öffentlichkeit und für weitere Sonderkulturen (Bsp. Obstanbau) ermöglichen zu können.
Ziel des Vorhabens ist es, an der Hochschule Geisenheim ein Agro-Photovoltaik-Reallabor im Freiland für die weinbauliche Forschung, für die technische Weiterentwicklung und vor allem für den APV-Wissenstransfer für Betriebe und Bevölkerung zu schaffen und mögliche Synergien, sowie Anpassungs- und Mitigationsstrategien an den Klimawandel für die Praxis zu entwickeln, zu erproben und zu optimieren. Die APV-Anlage dient als F&E Innovationsplattform der HGU-Forschungsinfrastruktur „Weinberg“.
Projektanfang: 01.07.2020
Projektende: 30.06.2025
Förderer: Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
Ziel des Vorhabens VitiVoltaic4Future ist es, in einem neu zu schaffenden Reallabor für den Einsatz von Agrophotovoltaik (APV) Forschung für den Weinbau zu betreiben. Die Infrastruktur soll auch über die Projektlaufzeit hinaus als Innovationsplattform dienen; sie soll Forschung, Entwicklung und Wissenstransfer ermöglichen, sowie gesellschaftliche Partizipation bei der Ausgestaltung der Energiewende am praktischen Beispiel ermutigen. Ein übergeordnetes Ziel ist, die Landnutzung bei Sonderkulturen (hier am Beispiel des Weinbaus) nachhaltiger zu gestalten, neue Wege für die Anpassung des Anbaus von Sonderkulturen an den Klimawandel zu eröffnen und zugleich im Rahmen der Energiewende erneuerbare, dezentrale Stromerzeugung plus landwirtschaftliche Produktion in der Fläche iterativ mit den betroffenen Akteuren zur Anwendungsreife zu entwickeln.
Das konkrete Ziel von VitiVoltaic4Future ist es, die Effekte und Möglichkeiten von Weinbau unter der ersten Agro-PV-Anlage Deutschlands zu quantifizieren, Daten für den Wissenstransfer bereit zu stellen und Anpassungsstrategie-Möglichkeiten, die durch solche Solarinseln entstehen könnten, durch weinbauliche Forschung und Know-How Aufbau wissenschaftlich zu begleiten. Im Rahmen des Projekts werden Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung im Weinbau (--> Projekt "AMBITO) integriert. Wir streben insbesondere die Verknüpfung von "Sonneninseln" mit Biodiversitätsinseln in Weinbau-Kulturlandschaften an, um die Nachhaltigkeit des Weinbaus ganzheitlich zu fördern.
Projektanfang: 01.04.2020
Projektende: 31.03.2023
Förderer: Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
Ziel des Verbundprojektes "AKHWA" ist es, einen Beitrag zur Maßnahme L 19 des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 zu leisten. Das Verbundprojekt befasst sich mit der Erforschung der Umsetzung von Bewirtschaftungsmaßnahmen aus dem "Werkzeugkasten" der Regenerativen Landwirtschaft (ReLaWi) auf die Bodenfruchtbarkeit und Ökosystemleistungen, insbesondere im Hinblick auf den Wasserrückhalt im Boden, der vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und der jüngsten Hitzesommer immer wichtiger wird.
Projektanfang: 05.04.2019
Projektende: 30.11.2021
Förderer: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand
Im ZIM-Kooperationsprojekt mit der Prodana GmbH geht es um die Entwicklung eines neuen Batch-Reaktors zur Karbonisierung von betriebseigenen holzigen Reststoffen oder von Holzhackschnitzeln von Seitens der Start-up Firma. Die Aufgabe des Partners HGU besteht in der Entwicklung und Evaluierung von Pflanzenkohle-basierten organischen Düngemitteln unter Überprüfung ihrer Umweltwirkungen und Umwelt- und Ertrags-Wirksamkeit. An der HGU werden daher Tests mit Pflanzenkohlen aus der neuartigen Retorte vorgenommen, bei denen entweder im Gewächshaus ein umfänglicheres Screening verschiedener Kohle-Düngemittel-Kombinationen auf ihr Nitratretentionsvermögen und die mögliche N2O-Emissionsminderung erfolgt, oder im Freiland unter natürlichen Witterungsbedingungen eine Testung ausgewählter Kohle-Düngemittelkombinationen auf eine mögliche Ertragsteigerung und Verbesserung der Umweltbilanz geprüft wird. Die Ergebnisse des Projektpartners HGU sollen dazu dienen, den Batchprozess der Kohleherstellung entsprechend zu verbessern und eine Feld-Datengrundlage zu erarbeiten, die möglichen Interessenten und Anwendern zur Verfügung gestellt werden können.
Projektanfang: 01.01.2018
Projektende: 31.12.2019
Förderer: Deutscher Akademischer Auslandsdienst
In diesem DAAD-Projekt im Rahmen des Deutsch-Pakistanischen Austauschprograms des DAAD geht es um die Entwicklung und Anwendung von Biochar-basierten Düngemitteln zur Steigerung der Erträge bei zugleich reduzierten THG-Kosten pro Einheit Ertrag bzw. pro Landfläche. Hierzu werden v.a. in Pakistan Feldversuche angelegt und das Equipment beschafft und entwickelt, um im Feld THG-Flussmessungen durchzuführen. Im Projektverlauf besuchen die Pakistanischen Partner Geisenheim und erlernen die notwendigen Techniken.
Projektanfang: 01.04.2017
Projektende: 31.03.2019
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
BioCAP-CCS quantifiziert die globalen Potenziale und Auswirkungen von prospektiv großräumiger Landbewirtschaftung mit Biomasse-Plantagen, um durch Negativ-Emissionen die Erderwärmung auf 1,5° zu begrenzen (Mitigation) bzw. eine temporäre Überschreitung zu kompensieren. Das Vorhaben quantifiziert daher erstmalig das globale C-Potential für Pflanzenkohle-CCS unter dezidierter Berücksichtigung von Konkurrenzen um Land und Wasser mit Welternährungs- und Ökosystemschutzzielen.
Projektanfang: 01.01.2017
Projektende: 31.12.2020
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Ziel des Projekts "FACEING COMPENSATION" ist der zunächst rechnerische Ausgleich der unvermeidbaren CO2-Emissionen der experimentelle Plattform "Geisenheimer FACE Experimente" durch das Abschätzen der CO2-Emissionsminderungs- und Energieeinspar-potentiale am Standort Hochschule Geisenheim (HGU). Verschiedene Maßnahmen zur CO2-Kompensation sollen in ihrer Effektivität, den nötigen Investitionskosten und der Amortisierung verglichen und bewertet werden.