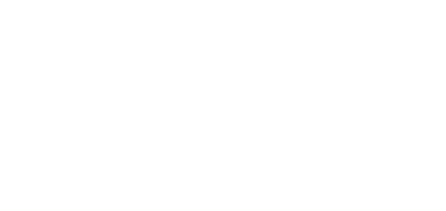Dr. Christine Becker
D-65366 Geisenheim
Raum 01.55
Von-Lade-Straße 2
65366 Geisenheim
Projektanfang: 01.07.2024
Projektende: 30.06.2026
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Biologische Verfahren zur Kontrolle von Schadarthropoden auf Basis einer Förderung und längerfristigen Ansiedlung von Antagonisten werden bislang im Anbau von Freilandkulturen in Deutschland nur unzureichend genutzt. Ein wesentliches Hindernis liegt hierbei in der Mobilität und der damit verbundenen Abwanderung der Antagonisten von der betreffenden Zielkultur. Blühstreifen stellen ein mögliches Element zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Antagonisten und damit zur Optimierung der Ökosystemdienstleistung „Schädlingsregulierung“ dar. Übergeordnetes Ziel des Vorhabens HIPSteR ist daher die Nutzbarmachung volatiler Semiochemikalien (Herbivore-Induced Plant Volatiles, HIPVs) zur Steigerung der Attraktivität von Blühstreifen für Antagonisten im Sinne einer „Attract-and-Reward-Strategie“ (A&R Strategie). Exemplarisch soll diese innovative Strategie zur nachhaltigen und biologischen Regulierung von Schadarthropoden im ökologischen Weinbau implementiert werden, eine spätere Übertragbarkeit auf andere Freilandkulturen ist vorgesehen.
Zur Erreichung des Projektziels sollen folgende Teilergebnisse erarbeitet werden: (1) Eine praxisreife, innovative Formulierung ausgewählter HIPVs mittels Mikroverkapselung erlaubt eine Applikation im Freiland und gewährleistet die Abgabe der HIPVs in ausreichender Menge und über einen hinreichenden Zeitraum. (2) Es können Aussagen zu notwendigen Aufwandmengen und Applikationsintervallen der formulierten HIPVs und ihrer Attraktivität für ausgewählte Antagonisten getroffen werden. (3) Die Wirksamkeit der A&R-Strategie ist unter kontrollierbaren Bedingungen optimiert und in Praxisbetrieben getestet worden. (4) Der weinbaulichen Praxis stehen Handlungsempfehlungen für die Aussaat und Pflege des Blühstreifens bzw. der Begleitpflanze sowie für die Applikation formulierter HIPVs auf Blühstreifen und damit für die Anwendung der Attract-and-Reward-Strategie im Weinbau zur Verfügung.
Projektanfang: 01.01.2024
Projektende: 31.12.2027
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Die Anpassung an den Klimawandel mit zunehmender Trockenheit ist derzeit eine der größten Herausforderungen für die Landwirtschaft. Über die Integration tiefwurzelnder annueller oder mehrjähriger Pfahlwurzelpflanzen in die Fruchtfolgen können Mischkulturen Ressourcen effizienter nutzen und es ist somit höhere Trockenstresstoleranz zu erwarten. Gleichzeitig sollten Pflanzengesundheit, Klimaschutz durch Kohlenstoffspeicherung in den Böden und Artenvielfalt zunehmen. Diese Hypothesen prüft das Projekt „TRIO: Transformative Mischkultursysteme für One Health“, das als Verbundprojekt zwischen der Hochschule Geisenheim und den Universitäten Kassel und Gießen bearbeitet wird und über ein LOEWE-Schwerpunktprogramm gefördert wird, über den gemeinsamen Anbau der Heil- und Gewürzpflanzen Fenchel, Kümmel und Koriander als Mischkulturpartner mit Weizen. Im Institut für Phytomedizin der Hochschule Geisenheim wird das Teilprojekt „Diversität, Nahrungsnetze und Wanderbewegungen von Arthropoden in Mischkultursystemen“ untersucht. Arthropoden erbringen wichtige Ökosystemleistungen, die u.a. relevant für Pflanzengesundheit und Ertrag sind. Entsprechend der Hypothese der biotischen Resistenz kann biologische Vielfalt in einem Anbausystem die Schäden durch Schädlinge mindern und zugleich die Produktivität erhöhen. Dies wird in diesem Teilprojekt über eine vergleichende Analyse der Arthropodendiversität und ihren ökosystemaren Funktionen in Misch- im Vergleich zu den entsprechenden Reinkulturen geprüft und vergleichend analysiert. Neben der Analyse der Diversität werden Wanderbewegungen von Nutzarthropoden zwischen Mischungspartnern erfasst und volatile Pflanzenstoffe der Mischungspartner hinsichtlich ihrer Attraktivität für ausgewählte Nützlinge und Schädlinge in Wahlversuchen bewertet.
Projektanfang: 01.11.2021
Projektende: 31.10.2024
Förderer: Europäische Kommission, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
ResBerry setzt sich zum übergeordneten Ziel, über Maßnahmen zur Förderung der ober- und unterirdischen biologischen Vielfalt die Resilienz des europäischen ökologischen Beerenobstanbaus gegen die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten zu erhöhen. Hierzu wird ResBerry folgende Strategien prüfen und bewerten: a) Implementierung präventiver Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch das Management von Lebensräumen für natürliche Feinde in ökologischen Beerenobstanlagen über die Einbeziehung von Begleitpflanzen in Form von Blühstreifen, Fangpflanzen und/oder Bodendeckern als Begrünungspflanzen, unterstützt durch ein optimiertes Erziehungssystem; b) Entschlüsselung der Zusammensetzung mikrobieller Gemeinschaften im Boden ökologischer Beerenobstanlagen, ihrer Beeinflussung durch Begleitpflanzen sowie Erprobung möglicher Maßnahmen zur Förderung nützlicher Bodenmikroorganismen als Präventivmaßnahme gegen bodenbürtige Krankheitserreger und zur Förderung der pflanzlichen Widerstandsfähigkeit; c) Sensibilisierung der Landwirt*innen für einen Einsatz innovativer Schädlingsbekämpfungsstrategien, wie z. B. entomopathogene Nematoden zur Bekämpfung der Kirschenessigfliege und Entomovectoring zur Kontrolle des Grauschimmels; d) Bewertung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf den Ertrag und die ernährungsphysiologische Qualität von Beeren und Auseinandersetzung mit den Erwartungen der Verbraucher*innen in Bezug auf diese Maßnahmen; e) Verbreitung und Weitergabe der Ergebnisse an Interessengruppen, Landwirt*innen, Marktorganisationen, Forscher*innen, Hochschulen, technische Dienste und Verbraucher*innen. Mit einer breiten geografischen Abdeckung von fünf europäischen Ländern wird sich das Projekt vor allem auf den Anbau von Erdbeeren und Himbeeren konzentrieren, aber auch weiteres Beerenobst berücksichtigen.
Projektanfang: 15.08.2018
Projektende: 14.10.2021
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Der bekreuzte Traubenwickler (Lobesia botrana), das wichtigste Schadinsekt im Weinbau, ist dank der Verwirrmethode in Deutschland momentan gut unter Kontrolle, was den Einsatz von Insektiziden im Weinberg massiv verringert hat. Ob die Methode allerdings auch unter zukünftigen klimatischen Bedingungen, wie erhöhter atmosphärischer Konzentrationen von Kohlendioxid (CO2), erfolgreich sein wird, ist bisher kaum untersucht.
Traubenwickler-Männchen folgen im Weinberg einer Duftspur aus Sexuallockstoffen (Pheromonen), um Weibchen zu finden und sich zu paaren. Bei der Verwirrmethode werden künstliche hergestellte Pheromone großflächig im Weinberg ausgebracht und überdecken die echten Duftspuren. So finden die Männchen nur noch selten Weibchen und eine Paarung findet kaum statt. Da erhöhte CO2-Konzentrationen die Physiologie von Insekten beeinflussen können, erforschen wir, ob sich (1) die Zusammensetzung der von den Weibchen abgegebenen Pheromone sowie (2) die Wahrnehmung der Pheromone durch die Männchen und deren Verhalten unter erhöhten CO2-Konzentrationen verändern.
Das Projekt “KlimaKom” ist ein Verbundvorhaben des Fachgebiets Angewandte Chemische Ökologie des Julius-Kühn Instituts in Dossenheim und des Instituts für Phytomedizin der HGU, gefördert durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Wir kombinieren Freiland- und Laborexperimente indem wir die Geisenheimer Free Air Carbon dioxide Enrichment (FACE)-Anlage im Weinberg sowie die Dossenheimer Windtunnel und Gaschromatografie-Elektroantennografie-Anlagen nutzen. Zusätzlich wird der Einfluss erhöhter atmosphärischer Ozonkonzentration untersucht.
Projektanfang: 01.03.2018
Projektende: 28.02.2021
Förderer: Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Ziel dieses Projektes ist die Erfassung der Auswirkungen von abiotischen Stressoren (insbesondere erhöhte atmosphärische CO2-Konzentration) auf die Interaktionen zwischen Reben und zwei Traubenwicklerarten (Lobesia botrana und Eupoecilia ambiguella). Hierzu sind Untersuchungen unter kontrollierten Bedingungen in Gewächshauskammern bzw. in der Weinbergs-FACE-Anlage der HGU geplant. Entwicklungsparameter der Traubenwickler unter verschiedenen CO2-Konzentrationen werden ebenso erfasst, wie Veränderungen im Expressionsmuster relevanter Gene während der Entwicklung der Larven auf Reben im Freiland unter erhöhter und ambienter CO2-Konzentration. Hierzu werden Untersuchungen des Transkriptoms mittels RNAseq erfolgen.
Datum: 21.02.2023
Ort: Bolzano (Italien)
Referent: Becker, Christine
Datum: 15.09.2022
Ort: Quedlinburg (Deutschland)
Referent: Becker, Christine
Datum: 21.07.2022
Ort: Helsinki (Finnland)
Referent: Becker, Christine
Datum: 27.04.2022
Ort: online (Deutschland)
Referent: Becker, Christine
Datum: 22.10.2018
Ort: Rennes (Frankreich)
Referent: Becker, Christine
Datum: 25.09.2018
Ort: Volos (Griechenland)
Referent: Becker, Christine
Datum: 02.07.2018
Ort: Neapel (Italien)
Referent: Becker, Christine