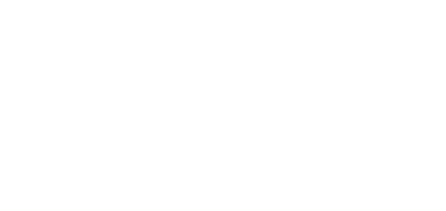Forschungsprojekte unseres Instituts
Projektanfang: 01.04.2023
Projektende: 30.09.2026
Förderer: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Die deutsche Apfelproduktion steht vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Um diesen Forderungen gerecht zu werden, wird ein Verbund aus institutionellen Apfelzüchtern und vielen der derzeit existierenden privaten Züchtungsinitiativen, der Fachgruppe Obstbau im Bundesausschuss Obst und Gemüse und der Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V. (FOEKO) gebildet, der sich den Herausforderungen stellen will. Dieser Verbund hat das Ziel, durch den Austausch von Züchtungsmaterial, Wissen und Know-how die zielgerichtete und systematische Züchtung standortangepasster Sorten in Deutschland bei allen Züchtungsinitiativen zu fördern.
Als erstes gemeinsames Ziel setzt sich dieser Verbund die Züchtung von Apfelsorten mit Resistenz gegenüber Apfelmehltau (Podospheara leucotricha) und Apfelschorf (Venturia inaequalis). Zur Entdeckung neuer Widerstandsfähigkeiten muss der Befall in Sortensammlungen, die über mehrere Jahre nicht mit Fungiziden behandelt werden, phänotypisiert werden.
Die Nutzung kolumnarer Apfelsorten ermöglicht zudem eine erhöhte Resilienz gegenüber Trockenstress und wird in Kombination mit Resistenzen gegenüber den beiden Schaderregern als weitere Möglichkeit gesehen, um den oben genannten Herausforderungen zu begegnen.
Resistenzgene in Sorten zu akkumulieren, bedingt aber die Nutzung einer markergestützten Selektion (englisch: Marker Assisted Selection – MAS). Dazu sollen kostengünstige und einfach anwendbare KASP-Assays (englisch: Kompetetive Allel-Spezifische PCR) entwickelt werden, die von allen Partnern unabhängig, je nach Züchtungsstrategie kombiniert werden können. Die Umsetzung der Analysen kann dann bei unabhängigen Anbietern beauftragt werden.
Projektanfang: 01.04.2023
Projektende: 31.03.2026
Förderer: Regierungspräsidium Tübingen, Europäische Kommission
Selbst in Obstbauregionen mit hohen Jahresniederschlägen wie im Bodenseegebiet (800-1300 mm), werden Trockenheits- und Hitzeperioden als Folge des Klimawandels häufiger. Viele Betriebe investieren als Anpassungsreaktion in Bewässerungsanlagen. Bei einer Steuerung nach Augenmaß wird oft zu viel oder zum falschen Zeitpunkt und ohne eine Dokumentation der ausgebrachten Mengen bewässert. Ziel des gemeinsamen Interreg-Projektes ist eine innovative Wasserbedarfsermittlung im Intensivobstbau im Bodenseegebiet. Es sollen objektive Entscheidungskriterien für ein ressourcenschonendes und sachgerechtes Wassermanagement auf den Betrieben in der Bodenseeregion mit Hilfe digitaler Technologien etabliert werden.
Projektanfang: 01.02.2019
Projektende: 31.12.2023
Förderer: Europäische Kommission, Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
Oberstes Ziel des Projekts ist es, den Anteil regionaler Rohstoffe bei der Produktion von Apfelsaft und Apfelwein zu erhöhen. Die hessischen Keltereien, die im Verband der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien organisiert sind, fördern seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Maßnahmen die Pflege und die Neupflanzung von Streuobstwiesen in Hessen.
Trotzdem werden immer weniger Äpfel zu den Keltereien bzw. in die Annahmestellen gebracht. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach regionalen Produkten durch den Verbraucher hoch und auch die hessische Landesregierung hat den Wunsch nach regionalen Produkten zum Ausdruck gebracht. Derzeit wird über die Anlieferung von Streuobst-Äpfeln in guten Jahren rund 20 % des Bedarfs gedeckt. Um den Anteil regionaler Rohstoffe zu erhöhen, soll in Hessen der Mostobstanbau eingeführt werden.
Es soll geklärt werden, welche Bedingungen für einen erfolgversprechenden Mostobstanbau notwendig sind.
Eine Standortkarte soll einen Überblick über die bereits vorhandenen Streuobstflächen und zusätzliche, geeignete Standorte für den Mostobstanbau verschaffen. Hier gibt es Überschneidungen mit einem neuen Projekt des HMUKLV "Biodiversität genießen", sodass Ergebnisse dieses Projektes einfließen können.
Die Themenbereiche Biodiversität und Artenvielfalt spielen bei der Streuobsterzeugung eine wichtige Rolle. Um auch beim Mostobstanbau einen Beitrag zum Naturschutz zu leisten, ist in Zusammenarbeit der Universität Gießen eine Untersuchung der Demonstrationsanlage der Kelterei Rapp's geplant. Somit kann auch in diesem Bereich auf Ergebnisse aus anderen Untersuchungen zurückgegriffen werden.
Projektanfang: 16.03.2020
Projektende: 15.05.2023
Förderer: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Das Projekt „Apfel4.NULL“ hat zum Ziel, die Nachhaltigkeit der deutschen Apfelproduktion durch
Automatisierung und digitale Technologien zu verbessern. Zu diesem Zweck wird ein Netzwerk
zerstörungsfreier Sensoren aufgebaut, um Daten zur gezielten Steuerung verschiedener Prozesse in der
Apfelproduktion und Lagerung einzusetzen. Neben den saisonalen Witterungsbedingungen werden die
wichtigsten Faktoren, die die Fruchtqualität und Haltbarkeit während der Qualitätsbildung im Feld und in der
Nachternteperiode beeinflussen, mit Sensoren überwacht. Regelungsmechanismen und Modellierungen
Bezug nehmend auf Wasser- und Fruchtstress sowie Baumwuchs werden entwickelt und die
Bewirtschaftung der Obstanlage (z.B. intelligenter Wurzelschnitt, Bewässerung) und Lagerung
entsprechend angepasst. In der „Apfel4.NULL“ Obstanlage wird das Pflanzenschutzmittel-Applikationsgerät
zum Digitalen Assistenten aufgerüstet. Dabei greift das Sprühgerät auf relevante Wetterdaten, LiDAR
Sensorik mit Analyse der Biomasse sowie GIS-Informationen mit gesetzlichen Abstandsauflagen zu. Die
bestehenden CA-Lagerungssysteme für Kernobst werden durch bedarfsgerechte Abtau-Algorithmen der
Kühlaggregate energieeffizienter und produktschonender gestaltet. Die Lagersteuerung baut dabei auf eine
intuitive Mensch-Maschinen-Schnittstellen Software. Diese ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung
der Fruchtqualität und gleichzeitig eine adaptive Steuerung der Lagerbedingungen unter Berücksichtigung
der fruchtqualitativen Parameter. Durch die Vernetzung der Daten der Projektpartner, daraus erstellter
Modelle und Aufzeichnungen ist die Transparenz und Kostensicherheit für alle Glieder der
Wertschöpfungskette Apfel langfristig geschaffen. Neue, im Projekt entwickelte Technologien werden über
eine Reihe von Industrie-Projektpartnern direkt in der kommerziellen Obstbaupraxis umgesetzt. Der Fokus dieses Teilvorhabens liegt auf der Integration des Bewässerungsmanagements in das Gesamtkonzept.
Projektanfang: 01.06.2018
Projektende: 31.01.2021
Förderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung
In diesem Projekt werden zwei innovative Ansätze (CRISPR/Cas und Biolistik) kombiniert, um eine effektive Methode zur Modifikation des Apfelgenoms zu entwickeln. Es wird ein neues Werkzeug für die Mutagenese des Apfels adaptiert und optimiert, ohne dass man auf die Agrobakterien-vermittelte stabile Transformation und/oder die Protoplasten-basierte Regeneration angewiesen ist. Eine derartige Methodik kann sowohl für die Forschung zur Entschlüsselung von Genfunktionen als auch, in Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen, für die Züchtung von Interesse sein. Im Projekt wird ein System zur transienten Transformation von Pflanzen entwickelt, indem mittels Biolistik Plasmide mit CRISPR/Cas- Konstrukten, die an Goldpartikeln gekoppelt wurden, mit hoher Geschwindigkeit in Pflanzenzellen eingebracht werden. Nach Regeneration der Zellen erhält man Pflanzen, bei denen die transiente Expression der CRISPR/Cas-Konstrukte zu genetischen Modifikationen geführt hat, wobei keine Fremd-DNA im Genom integriert werden sollte. In völlig DNA-freien Versuchsansätzen sollen Ribonukleoproteine (RNPs = Cas-Protein + “guide-RNA“) zum Einsatz kommen. Hierdurch wird das Risiko der Integration von Fremd-DNA ins Ziel-Genom komplett eliminiert. Weiterhin sollen guide-RNAs und Cas-RNAs verwendet werden, um eine DNA-freie Genommodifikation zu erzielen.
Die Anwendung dieser Technik bei Obstgehölzen kann einen Beitrag zur Untersuchung grundlegender biologischer Prozesse auf molekularer Ebene leisten und somit helfen, bislang unbekannte Genfunktionen, Geninteraktionen und regulatorische Prozesse schneller und effektiver zu entschlüsseln. Besonders aufgrund der hohen Heterozygotie und der langen juvenilen Phase von Obstgehölzen sind Züchtungen zeit- und kostenintensiv. Ausgewählte Kombinationen von gewünschten Merkmalen erfordern wiederholte und zugleich zeitintensive Rückkreuzungen. Durch den Einsatz des CRISPR/Cas-Systems können Eigenschaften gezielt verändert werden.
Projektanfang: 01.08.2017
Projektende: 30.06.2020
Förderer: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Der Klimawandel kann das Populationswachstum von Schadinsekten mit hoher gesellschaftlicher Relevanz in Hessen fördern (Klimaschutzkonzept Hessen 2012), in bestimmten Fällen aber auch hemmen. Eigene Vorarbeiten und Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass die Populationen von zwei Schadinsekten von hoher medizinischer und ökonomischer Relevanz, der Asiatische Buschmücke (Aedes japonicus japonicus) und der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii), unter zunehmend höheren Sommertemperaturen zusammenbrechen und es somit evtl. für Teile Hessens unter bestimmten Bedingungen zu einer Entlastung kommen kann. Die Populationsentwicklung der Asiatische Buschmücke und der Kirschessigfliege unter veränderten und saisonal heterogenen Temperaturregimes ist allerdings noch weitgehend unklar. In dem hier vorliegenden Antrag sollen Zeiträume und Regionen in Hessen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eines gesteigerten oder verringerten Befallsdrucks mithilfe von phänologischen Modellen, angetrieben durch ein Ensemble von Klimaprojektionen, identifiziert werden. Im parallel eingereichten Antrag PEST werden dazu wichtige Daten zu den Auswirkungen von spezifischen Temperaturschwankungen und Wetterextremen ermittelt, um in dem hier vorliegenden Antrag Abschätzungen im Kontext des Klimawandels zu einem gesteigerten bzw. einem verringerten Befallsdruck von beiden relevanten Insektenarten physiologisch fundiert zu ermöglichen. Dieser stark synergistische Effekt zwischen beiden Anträgen führt zu einem deutlichen Mehrwert für eine realitätsnahe Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Risiken, bzw. Schadenssituationen und damit zu einer soliden Entscheidungsgrundlage für die entsprechenden Behörden in Hessen.
Projektanfang: 01.03.2016
Projektende: 29.02.2020
Förderer: Europäische Kommission
Das von der Universität Málaga koordinierte EU-Projekt GoodBerry (Grant Agreement No 679303) beschäftigt sich mit Erdbeeren, Himbeeren und Schwarzen Johannisbeeren als Modellpflanzen und soll u.a. neue Erkenntnisse hinsichtlich der Anpassung von Sorten an unterschiedliche klimatische Bedingungen sowie deren Einfluss auf die Fruchtqualität der Beeren liefern. So hat die Klimaerwärmung einen Einfluss auf die Blütenanlage und die Kontrolle der Dormanz (Winterruhe) der Pflanzen. Erste Beeinträchtigungen sind im letzten Jahrzehnt auch unter deutschen Anbaubedingungen bei Erdbeeren oder Johannisbeeren zu beobachten gewesen. So führt mangelnde Winterkälte bei Erdbeeren zu kurzen Blüten/Frucht- und Blattstielen und verringerter Blattfläche. Warmes Herbstwetter einhergehend mit spätem Eintritt in die Winterruhe führt bei Erdbeeren außerdem zu einem übermäßigen Blütenansatz, was kleine Früchte von minderwertiger Qualität zur Folge hat. Durch den Anbau gleicher Sorten bzw. Kreuzungsnachkommen an verschiedenen Standorten vom Nord- nach Süd-Europa soll der Einfluss unterschiedlicher Klimazonen auf die Pflanzen untersucht werden, um so den Klimawandel zu simulieren. Neben der Phänotypisierung (Blüteninitiation, Wachstumsparameter) sollen mittels molekulargenetischer Analysen im Hochdurchsatzverfahren Blütenbildung, Kontrolle der Dormanz und Ausprägung der Fruchtqualität untersucht werden.
Projektanfang: 01.11.2016
Projektende: 31.10.2019
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Ziel des geplanten Vorhabens ist es, eine schnelle und zuverlässige Selektion von für den Anbau
besonders geeigneten Wuchsformen des Kolumnarapfels schon kurz nach der Aussaat zu erreichen. Dazu
soll eine Kombination von wenigen Markern identifiziert werden, die eine solche frühe Selektion ermöglicht.
In Kombination mit anderen schon bekannten Markern z.B. für das typische Apfelaroma (Rowan et al.,
2009; Souleyre et al., 2014) können so qualitativ hochwertige Sorten mit der optimalen Wuchsform schnell
und zuverlässig identifiziert werden. Um dieses Ziel zu unterstützen, werden auch Verfahren des „Fast
Breedings“ etabliert, damit in der Kombination mit den Markern für Wuchsform eine schnelle Nutzung neuer
Sorten in der Praxis ermöglicht werden kann. Damit wird eine zeitnahe Einführung eines effektiven und
wirtschaftlich tragfähigen Anbausystems ermöglicht, die eine standortnahe, also regionale Produktion von
Wirtschaftsobst für die Fruchtsaftindustrie auf Dauer sichert. Weiterhin wird damit auch für die Anbauer eine
wirtschaftliche Einkommensalternative geschaffen.
Projektanfang: 10.07.2017
Projektende: 31.03.2019
Förderer: Landwirtschaftliche Rentenbank
Phytoplasmen (Candidatus Phytoplasma) sind zellwandlose pflanzenpathogene Bakterien, die das Phloem von mehr als 700 Pflanzenarten, darunter viele wirtschaftlich wichtige Kulturpflanzen, besiedeln können. Sie verursachen eine Vielzahl von Symptomen, die in Abhängigkeit vom Phytoplasma-Stamm, der Wirtspflanze und den Umweltfaktoren variieren und häufig eine Verfärbung der Blätter, eine vermehrte Anzahl von Trieben („Hexenbesen“) und einen gestauchten Wuchs umfassen. In Weinreben (Vitis vinifera) verursachen Phytoplasmen bspw. Die sogenannten Vergilbungskrankheiten, bei Apfel (Malus domestica) die Apfeltriebsucht und in Birnen (Pyrus spp.) den sogenannten Birnenverfall. Phytoplasmen werden durch phloemsaugende Insektenvektoren, über Veredelung oder durch die vegetative Vermehrung infizierter Pflanzen verbreitet. Bekämpfungsstrategien für Phytoplasmen beruhen derzeit nur auf der Verhinderung ihrer Ausbreitung, da keine wirksamen Pflanzenschutzmittel gegen Phytoplasmen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus haben Phytoplasma-Erkrankungen lange Inkubationszeiten von bis zu mehreren Monaten, bevor Symptome beobachtet werden können. In diesem Projekt soll daher eine schnelle und zuverlässige molekulare Nachweismethode für Phytoplasmen entwickelt werden, die auf LAMP- bzw. TaqMan-Assays basiert und bei der Produktion und Kultur von vegetativ vermehrten Pflanzen wie Weinreben, Äpfeln oder Birnen verwendet werden kann.
Projektanfang: 01.03.2013
Projektende: 31.12.2016
Förderer: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Die Rubus stunt gilt als die wichtigste Phytoplasmose an Himbeeren und kann Ertragsausfälle von bis zu 100% hervorrufen. Mit den bisher zur Verfügung stehenden Diagnoseverfahren werden latent infizierte aber auch symptomatische Pflanzen nicht einwandfrei erkannt. Zudem sind potentielle Vektoren und mögliche Übertragungswege unbekannt. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung eines hoch-sensitiven und schnellen molekularen on-site Testsystems zur frühzeitigen Diagnostik dieser Phytoplasmose. Zudem sollen Erkenntnisse zum Artenspektrum potentieller Vektoren und weiteren Übertragungswegen gewonnen werden, die als Grundlage für die Entwicklung gezielter und termingerechter Bekämpfungsmaßnahmen dienen.
Die Entwicklung einer molekularen Methode zur Diagnose der Rubus stunt soll nach Etablierung eines on-site Probenahmeprotokolls auf Basis von TaqMan Sonden, LAMP-Assays und markierungsfreier Detektion erfolgen. Untersuchungen zu Artenspektrum und Phänologie potenzieller Vektoren, weiteren Übertragungswegen, der Anfälligkeit von Himbeersorten sowie zu gezielten Bekämpfungsmaßnahmen sollen in einem Himbeervermehrungsbetrieb bzw. in Ertragsanlagen erfolgen. Darauf aufbauend sollen Managementstrategien im Zuge der Vermehrung bzw. Kultivierung von Himbeeren entwickelt werden. Schließlich sollen die erarbeiteten Methoden zur molekularen Phytoplasmendiagnostik unter Feldbedingungen validiert und für einen Nachweis von Phytoplasmen auf andere Kulturpflanzen übertragen werden.
Projektanfang: 01.05.2011
Projektende: 31.10.2014
Förderer: Europäische Kommission
Himbeeren werden heute, neben dem traditionellen Anbau im Freiland, zunehmend im geschützten Anbau, d.h. unter Regenkappen aus Plastik, im Tunnel oder Gewächshaus kultiviert. Ziel ist es, die empfindlichen Früchte vor Witterungseinflüssen zu schützen bzw. den Angebotszeitraum für Himbeerfrüchte aus zu dehnen. Für die Eindeckung von Regenkappen und Tunneln stehen mittlerweile verschiedene Materialien zur Verfügung.
Himbeeren sind reich an Vitamin C und enthalten zudem eine Vielzahl an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Den Pflanzen dienen hierbei die Polyphenole als Farb-, Duft- oder Lockstoffe (Anthocyane, Flavonoide), sowie als Abwehrstoffe (Ellagtannine) gegen Pathogene. Diese Polyphenole werden aber auch bei abiotischen Stress gebildet und schützen durch ihre antioxidative Wirkung die Pflanzen vor freien Radikalen und deren oxidative Schäden. Neben der Schutzfunktion für die Pflanzen besitzen Polyphenole aber auch eine gesundheitsfördernde Wirkung für Menschen. So soll u.a. das Risiko von Krebs, Arteriosklerose, Herz-Kreislaufbeschwerden und neurodegenerativen Erkrankungen bei Obst und Gemüse reicher Ernährung und damit polyphenolreicher Nahrung reduziert sein.
Bisher liegen nur wenige Erfahrungen vor, welchen Einfluss die erhöhten Temperaturen sowie die verringerte Luftbewegung im geschützten Anbau und verschiedene Tunnelfolien (mit und ohne UVB-Durchlässigkeit bzw. schattierend) auf die Photosyntheseleistung der Himbeerpflanzen und damit auf ihren Kohlenhydrathaushalt haben. Die veränderten Stoffwechselaktivitäten könnten auch die Synthese der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe beeinflussen
Daher soll in einem Vergleich von Freiland- und Tunnelanbau der Einfluss veränderter Umweltbedingungen wie Lichtintensität und –qualität, Temperatur und rel. Luftfeuchte auf Photosynthese und Kohlenhydrathaushalt von Himbeerpflanzen sowie die Bildung von sekundären Inhaltsstoffen in Blättern und Früchten erarbeitet werden.