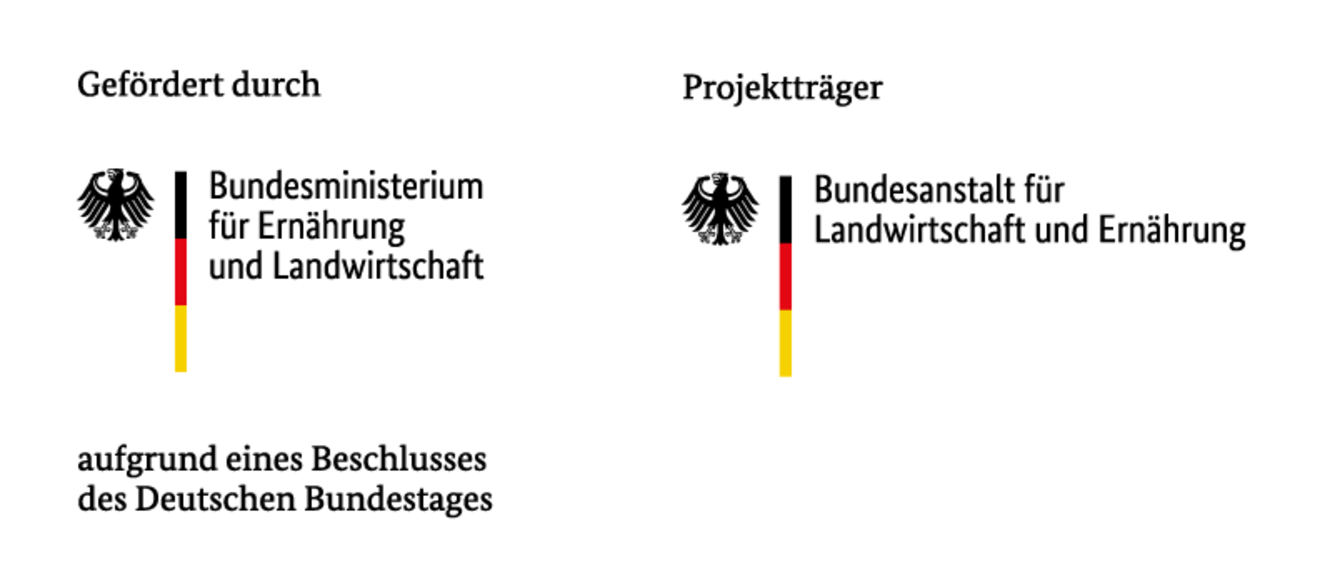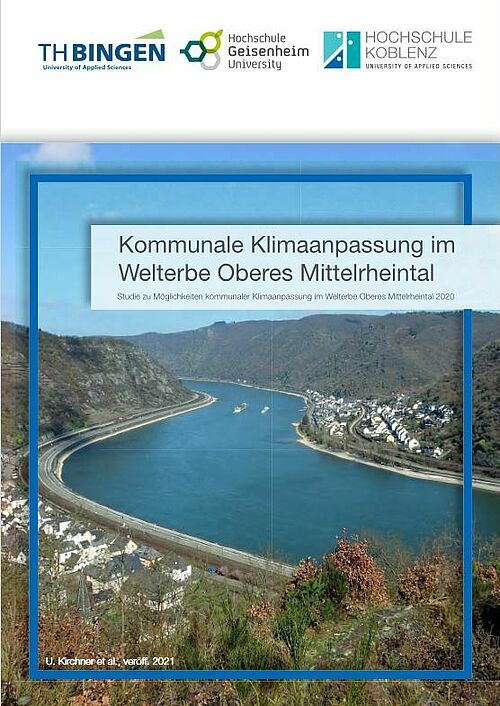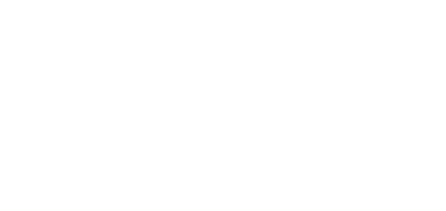Forschungsprojekte
Auf dieser Seite erhalten Sie Einblicke in die Forschung und Projekte mit denen sich die Forschenden des Instituts für Landschaftsplanung und Naturschutz derzeit beschäftigen.
→ In-situ-Erhaltung von Wildpflanzen
→ Kommunale Klimaanpassung im Welterbe Oberes Mittelrheintal
→ Landschaftsmosaik Oberes Mittelrheintal
→ Vogeldiversität in Weinbaugebieten
→ Ausgleichsflächen bei Verkehrsinfrastrukturprojekte (AFIW)
In-situ-Erhaltung von Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft mittels Schirmarten (IsWEL)
Im Fokus des Projekts stehen Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft (WEL), d.h. wildwachsende Verwandte der Kulturpflanzen und potenziell für Ernährung und Landwirtschaft nutzbare Pflanzenarten. Sie sind häufig nicht Zielarten von Erhaltungsmaßnahmen. Für den Ausbau des Netzwerks Genetischer Erhaltungsgebiete Deutschland werden wir Schirmarten für WEL identifizieren, WEL-Hotspots für die Einrichtung genetischer Erhaltungsgebiete (GenEG) benennen und GenEG in Modellregionen einrichten. Mit der Fokussierung auf WEL-Hotspots und dem Schirmartenansatz, bei dem mehrere Arten vom Management für einige wenige Arten profitieren, zielt das Projekt darauf ab, möglichst viele WEL und deren innerartliche Vielfalt unter Aufwendung möglichst weniger Ressourcen zu bewahren.
IsWEL
Ein GenEG ist definiert als eine Fläche, die für aktive und dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen ausgewiesen wird und auf der Management und Monitoring der genetischen Vielfalt natürlich vorkommender Wildpflanzen-Populationen erfolgen. Die aktive Erhaltung soll dabei prioritär für WEL-Arten mit wirtschaftlicher Relevanz stattfinden. Eine vorläufige Liste prioritärer Arten (134 Taxa) hat der Beratungs- und Koordinierungsausschuss für genetische Ressourcen landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Kulturpflanzen (BEKO) im Jahr 2019 verabschiedet. Die GenEG-Erhaltungstechnik wurde in mehreren Projekten (Wildsellerie, Wildapfel, Wildrebe, Grünland) erprobt, die stets von einem engen Artenspektrum oder ähnlichen Biotoptypen ausgingen. Im Gegensatz zu diesen Projekten liegt der Schwerpunkt nun auf WEL-Hotspots in verschiedenen Biotoptypen. Damit hat das Projekt einen breiteren und grundlegend neuen Ansatz. Da die langfristige Finanzierung von GenEG noch nicht gesichert ist, werden Empfehlungen für die strukturelle Finanzierung erarbeitet.
Zielarten: Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft (WEL), insbesondere die, welche entsprechend des BEKO als bedeutende Ressource für die Pflanzenzüchtung prioritär zu erhalten sind
Projektziele: Effiziente Erhaltung und erleichterter Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen durch
- Systematische Identifikation von WEL-Arten-Hotspots in verschiedenen Biotoptypen
- Erprobung und Umsetzung des Schirmarten-Ansatzes in den WEL-Arten-Hotspots
- Charakterisierung von ausgewählten WEL-Arten-Hotspots und Evaluierung des Managements
- Einrichtung genetischer Erhaltungsgebiete an den ausgewählten WEL-Arten-Hotspots
- Einlagerung von WEL-Saatgutproben in der Genbank WEL (mehr Informationen zur Genbank unter https://www.genbank-wel.uni-osnabrueck.de)
- Empfehlungen zur strukturellen Finanzierung zur In-situ-Erhaltung von WEL
Vorgehensweise:
Zuerst werden wir Fundortangaben zu WEL-Arten in Deutschland sammeln, eine Inventarliste erstellen und WEL-Arten-Hotspots identifizieren. Für WEL-Arten in den Hotspots werden wir mittels der Art-Häufigkeit, Sensibilität gegenüber Störungen und Anzahl sympatrischer Vorkommen mit anderen Arten den Schirmarten-Index nach Fleishman et al. (2000, 2001) berechnen. Mittels weiterer Kriterien in Anlehnung an Jedicke (2016) werden wir schließlich die WEL-Schirmarten bestimmen. Anschließend werden wir rund 100 Hotspot-Flächen mit Schirmarten als Kandidaten für GenEG identifizieren. Für mindestens 30 dieser Flächen werden im Sommer des Jahres 2021 Vor-Ort-Begutachtungen zur Erfassung von WEL sowie zur Evaluierung des Erhaltungszustandes und des Managements der WEL-Schirmarten stattfinden. Von zwei WEL-Schirmarten werden wir dabei Blattproben mehrerer Vorkommen für die Untersuchung genetischer Differenzierungsmuster sammeln. Anhand der Evaluierung und der Ergebnisse der genetischen Analyse werden zum Jahr 2023 Flächen für die Einrichtung von GenEG nominiert werden. Relevante Fördermöglichkeiten werden wir evaluieren und Maßnahmen- und Finanzierungsvorschläge zur In-situ-Erhaltung von WEL erarbeiten. Bei Flächen, für die die Einrichtung von GenEG vorgeschlagen wird, werden standortspezifische Planungen zur Erhaltung der WEL-Vorkommen und die Sammlung von Saatgutproben zur Einlagerung in die Genbank WEL sowie die Abstimmung mit lokalen Akteuren erfolgen, um mindestens 15 GenEG einzurichten.
Projektpartner:
- Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen (Quedlinburg)
- Dr. Nadine Bernhardt und M. Sc. Maria Bönisch
- Projekt-Koordination, Identifikation von WEL-Arten-Hotspots und WEL-Schirmarten, genetische Untersuchungen, Planung und Einrichtung genetischer Erhaltungsgebiete
- Dr. Nadine Bernhardt und M. Sc. Maria Bönisch
- Hochschule Anhalt (HSA), Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung (Bernburg)
- Prof. Dr. Sabine Tischew, M. Sc. Thomas Engst und M. Sc. Vera Senße
- Identifikation von WEL-Arten-Hotspots und WEL-Schirmarten, Entwicklung einer Gebietskulisse, Charakterisierung von WEL-Vorkommen und Evaluierung der bestehenden Flächenbewirtschaftung bei ausgewählten Flächen
- Prof. Dr. Sabine Tischew, M. Sc. Thomas Engst und M. Sc. Vera Senße
- Hochschule Geisenheim University (HGU), Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz & Kompetenzzentrum Kulturlandschaft (KULT)
- Prof. Dr. Eckhard Jedicke und Dr. Martin Reiss
- Evaluierung relevanter Fördermöglichkeiten, Maßnahmen- und Finanzierungsvorschläge
- Prof. Dr. Eckhard Jedicke und Dr. Martin Reiss
Kontakt:
Julius Kühn-Institut (JKI) – Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen
Institut für Züchtungsforschung an landwirtschaftlichen Kulturen
Nadine Bernhardt
Erwin-Baur-Str. 27, 06484 Quedlinburg
E-Mail: nadine.bernhardt(at)julius-kuehn.de
Tel.: 03946/47-701
Projektträger:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Förderkennzeichen 2819BM040
Projektlaufzeit: 1. Juli 2020 - 31. Dezember 2023
Förderkennzeichen: 2819BM040–042






Kommunale Klimaanpassung im Welterbe Oberes Mittelrheintal
Für das Jahr 2029 wird im Gebiet des Oberen Mittelrheintals die Durchführung einer Bundesgartenschau geplant. Damit sollen im Tal neue Impulse zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität sowie zur Förderung des Tourismus gesetzt werden.
Zur Vorbereitung der Bundesgartenschau 2029 wurde die Studie "Kommunale Klimaanpassung im Welterbe Oberes Mittelrheintal" erstellt. Sie zeigt die Möglichkeiten der kommunalen Klimaanpassung in dieser Region auf. Die Studie wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Entwicklungsagentur RLP e. V. und der TH Bingen, der Hochschule Geisenheim University sowie der Hochschule Koblenz in den Jahren 2019/2020 erarbeitet und durch die Entwicklungsagentur RLP e. V. finanziell unterstützt.
Mittelrheintal

Das Gebiet des Welterbes Oberes Mittelrheintal plant für das Jahr 2029 die Durchführung einer Bundesgartenschau. Damit sollen im Tal neue Impulse zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität sowie zur Förderung des Tourismus gesetzt werden. Der Klimawandel und die Art und Weise, wie sich die Kommunen in der Region auf dessen Folgen einstellen, gehören zu den Faktoren, die Einfluss darauf haben können, ob und in wie-weit die Erwartungen an die BUGA erfüllt werden können. Kommen genügend Besucher, wenn die Sommer erdrückend heiß werden, reichen die veranschlagten Mittel für den steigenden Wasserbedarf der Pflanzungen, wie sorgt man für das Wohlbefinden der Besucher und wie schützt man sie bei eventuellen Sturzfluten? Nicht zuletzt geht es um die Vorsorge für gesunde Lebens- und Existenzbedingungen für die Menschen, die hier auch nach der BUGA dauerhaft leben und arbeiten wollen. Die Art und Weise, wie sich die Kommunen in der Region auf den Klimawandel vorbereiten, ihn in ihren Planungen vorausschauend berücksichtigen und ihre Kommunen schützend stärken, wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein (U. Kirchner et al., 2021)
Diese Studie wurde im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Entwicklungsagentur RLP e.V. und den drei Hochschulen Technische Hochschule Bingen, Hochschule Geisenheim University und Hochschule Koblenz unter Federführung der Hochschule Koblenz in 2019/2020 erstellt und durch die Entwicklungsagentur RLP e.V. finanziell unterstützt.
Auszug aus der Veröffentlichung:
Im Jahr 2029 soll im Gebiet des Welterbes Oberes Mittelrheintal eine Bundesgartenschau stattfinden. Damit sollen im Tal neue Impulse zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität sowie zur Förderung des Tourismus gesetzt werden.
Der Prozess hierzu ist seit Jahren im Gange: Zunächst wurde eine Machbarkeitsstudie zur Bundesgartenschau in diesem Gebiet durchgeführt und die Kommunen sind im intensiven Dialog über Zielsetzungen, Konzepte und Maßnahmen. Viele Gemeinden rüsten sich und planen ihre Orte zu entwickeln, neue Lebens- und Aufenthaltsqualitäten zu schaffen, die Attraktivität für Bewohner und mögliche Gäste zu steigern. Der Klimawandel und die Art und Weise, wie sich die Kommunen in der Region auf dessen Folgen einstellen, gehören zu den Faktoren, die Einfluss darauf haben können, ob und inwieweit die Erwartungen an die BUGA erfüllt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde die Arbeitsgemeinschaft der drei beteiligten Hochschulen (Hochschule Koblenz, Technische Hochschule Bingen und Hochschule Geisenheim) gebildet, um für die Kommunen im Tal eine Studie zur Klimaanpassung zu erstellen.

Landschaftsmosaik Oberes Mittelrheintal

Die einzigartige durch Wein und Obst bestandene Terrassenlandschaft entlang des Oberen Mittelrheins mit europäischen Schutzgebieten durchläuft einen tiefgreifenden Wandel durch Nutzungsaufgabe und Sukzession. Vor diesem Hintergrund werden im UNESCO-Welterbe die gesellschaftlichen Ziele und Chancen der Entwicklung einer mosaikartigen, vielfältigen Steillagen‐Landschaft geprüft, Hemmnisse und förderliche Bedingungen ermittelt und erste Reaktivierungen von Flächen zu nachhaltig nutzbaren Bereichen durchgeführt. Vorliegende großräumige Ziele und Maßnahmeempfehlungen werden lokal heruntergebrochen. Damit soll eine Zukunftsvision für eine nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft entstehen, die ökologische, ökonomische und soziale Ziele beinhaltet und von den Akteuren im Raum mitgetragen wird. Zugleich wird ein Folgeprojekt zur größerflächigen Umsetzung vorbereitet.
WELMO
Wie kann die historische und einzigartige, ehemals großflächig durch Wein und Obst bestandene Terrassenlandschaft entlang des Oberen Mittelrheins für die Zukunft erhalten und entwickelt werden? Große Flächen entlang des Rheins und der Nebentäler sind brachgefallen. Nach Aufgabe der Nutzung verbuschen die ehemals offen gehaltenen Flächen und wandeln sich sukzessive zu Wald. So verschwinden spezielle Lebensräume und ändert sich das kulturhistorisch geprägte Landschaftsbild - die landschaftliche Vielfalt geht zurück.
Das Kompetenzzentrum Kulturlandschaft (KULT) an der Hochschule Geisenheim entwickelt im Projekt “Landschaftsmosaik Welterbe Oberes Mittelrheintal” gemeinsam mit den Menschen in der Region Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung. Neben einer Analyse des Handlungsbedarfs steht die Identifikation exemplarischer Lösungsansätze und deren Realisierung im Vordergrund.
Seit April 2022 arbeiten die Landschaftsplanerinnen Elena Simon und Jenny Eckes an der Umsetzung. Zunächst stehen drei Modellkommunen im Fokus – Bacharach, Spay und Lorch. Im Dialog mit den Akteuren und Landnutzenden vor Ort werden für landschaftsbildprägende Teilflächen der Gemeinden jeweils Handlungsfelder und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Anschließend soll es in die praktische Umsetzung gehen, um die Landschaft mosaikartig nachhaltiger zu gestalten und zu nutzen. Die unterschiedlichen thematischen Schwerpunkte in den drei Modellkommunen betreffen vielfältige Herausforderungen sowie Optionen zur Nutzung und Gestaltung der Landschaft, die stellvertretend für die Entwicklungsaufgaben im gesamten Oberen Mittelrheintal stehen. Unter anderem geht es um den Umgang mit verbuschenden und schwer zu bewirtschaftenden Steilhängen, die Reaktivierung von Weinbergen, die Erhaltung und Inwertsetzung kulturhistorischer Zeugnisse in der Landschaft, die Wirtschaftlichkeit des Anbaus klimaangepasster Obstsorten, Möglichkeiten zur Offenhaltung von Landschaften und ganz zentral den Umgang mit künftigen Klimawandelfolgen. Mit standardisierten Maßnahmenblättern wollen die Planerinnen die Umsetzungswege der gemeinsam mit der Region entwickelten Maßnahmen später auf weitere Flächen übertragen. In einem möglichen Folgeprojekt können die lokal gewonnenen Erkenntnisse auf das gesamte Mittelrheingebiet abstrahiert und ein Maßnahmenkatalog mit vielfältigen Optionen für die Landschaftsentwicklung in der Fläche entwickelt werden.
Gefördert wird das Vorhaben unter Leitung von Prof. Dr. Eckhard Jedicke und Dr. Jörn Schultheiß von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz und vom Regionalpark RheinMain. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal.



Vogeldiversität in deutschen Weinbaugebieten

Weinanbaugebiete bieten der Avifauna potenziell attraktive Lebensbedingungen: Die Holzstrukturen der Reben, Begrünung zwischen den Rebzeilen sowie ein Mosaik mit angrenzenden ungenutzten Strukturen können für viele Arten geeignete Habitatelemente darstellen. In vielen Fällen jedoch ist der Weinbau von intensiven Managementregimen mit häufigen Störereignissen wie Bodenbearbeitung, Pestizidanwendung und/oder Mahd der artenarm begrünten Gassen und Beseitigung von Randstrukturen geprägt.
Verschiedene Studien zeigen, dass gerade diese Faktoren in Monokulturen großen Einfluss auf die Vogeldiversität haben weshalb in diesem Promotionsprojekt der Einfluss von Landschaftsstrukturen und Managementregimen auf die Vogeldiversität im Jahresverlauf am Beispiel von Rheingau und Rheinhessen untersucht werden soll. Auf Grundlage dieser Ergebnisse soll ein landschaftsspezifisch anpassbares Handlungskonzept zur Förderung der Vogeldiversität in Weinanbaugebieten erstellt werden.
Vögel
Hintergrund:
Methoden der intensiven Landnutzung und Strukturverarmung von Landschaften wirken sich nachweislich stark negativ auf die Biodiversität in Agrarlebensräumen aus (z.B. Chamberlain et al. 2000; Arlettaz et al. 2012). Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen und wachsender Ertragsansprüche an weniger Fläche ist das nachhaltige Management der Nutz-Biotoptypen in Agrarlandschaften ein Schlüsselthema der Biodiversitätsforschung geworden (Chapin et al. 2000). Vögel der Agrarlandschaft haben wie keine andere Vogelartengruppe in den letzten Jahren bundes- und auch europaweit massive Bestandseinbrüche erlebt (DO-G & DDA 2011; Wahl et al. 2015). Der überwiegende Teil der hierzu durchgeführten Forschungsprojekte bezieht sich auf annuelle Kulturen (Pithon et al. 2015). Permanente Kulturen, wie z.B. Streuobstwiesen, Weinbaugebiete und Holzplantagen, erhalten in der Biodiversitätsforschung bis heute jedoch wenig Aufmerksamkeit (Tandini et al. 2012).
Forschungsziel:
Das Forschungsziel dieser Arbeit besteht darin, die Vogeldiversität in deutschen Weinbaugebieten unter Nachweis des Einflusses von Landschaftsstrukturdiversität und Managementregimen am Beispiel von Rheingau und Rheinhessen zu analysieren und hieraus ein biodiversitätsförderndes Managementkonzept abzuleiten.


AFIW: Ausgleichsflächen bei Verkehrsinfrastrukturprojekte im Licht von Klima- und Landschaftswandel
Ziel des länderübergreifenden Projektes der D-A-CH-Länder ist es, Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes verursacht durch Verkehrsinfrastrukturprojekte langfristig zu mindern.
Ende 2022 ist das neue Projekt am Institut für Landschaftsplanung und Naturschutz gestartet. Wie können die Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht durch Verkehrsinfrastrukturprojekte nachhaltiger und langfristig verbindlich ausgeglichen werden? In dem länderübergreifenden Projekt werden die Umsetzungspraxis von Ausgleichsflächen sowie die vorhandenen Ausgleichsflächen-Kataster und Ökokontoregelungen analysiert und dargestellt. Zudem geht es darum, die aktuellen, nationalen, rechtlichen Rahmenbedingungen darzulegen. Neben der Erfassung des Status Quo sollen durch die Verknüpfung von Ökologie, Planung und Recht Umsetzungsempfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung von Ausgleichsflächen bei Verkehrsinfrastrukturprojekten erarbeitet werden. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf den zukünftigen Herausforderungen von Klima- und Landschaftswandel.
AFIW
Projektstart: 01.08.2022
Projektende: 31.12.2024
Projektleitung:
Raphael Süßenbacher (E.C.O, Projektleitung AT), Marianne Darbi (HGU, Teilprojektleitung DE), Juliane Albrecht (IÖR, Teilprojektleitung DE), Robert Meier (ARNAL, Teilprojektleitung CH)
Zusammenfassung
Autobahnen- und Schnellstraßenvorhaben führen regelmäßig zur Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Um diese Eingriffe zu kompensieren, besteht das Instrument der Ausgleichsmaßnahmen. Die rechtlichen Bestimmungen sowie die praktische Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen sind sehr uneinheitlich geregelt. Sowohl zwischen den D-A-CH Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) als auch innerhalb dieser einzelnen Länder aufgrund föderaler Strukturen. Dies führt schlussendlich dazu, dass kein langfristiger Ausgleich garantiert werden kann. Zudem ist die langfristige Planung und Betreuung von Ausgleichsmaßnahmen bedingt durch die Veränderung von Klima und Landschaft zunehmend herausfordernd.
Aus diesem Grund werden die zentralen Inhalte von Ausgleichsmaßnahmen länderübergreifend analysiert und dargestellt. Das zentrale Ziel ist neben der zusammengefassten Darstellung des Status Quo für alle D-A-CH-Länder insbesondere die Formulierung von Umsetzungsempfehlungen für die Praxis. Dies betrifft sowohl die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die konkrete Umsetzungspraxis, bei der mit Ausgleichsflächen-Kataster und Ökontoregelungen auch spezielle Instrumente untersucht werden.
Förderer:
Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Deutschland;
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Österreich;
Bundesamt für Strassen ASTRA, Schweiz